Avengers: Endgame, USA 2019 • 181 Min • Regie: Joe & Anthony Russo • Mit: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Karen Gillan, Paul Rudd, Brie Larson • FSK: ab 12 Jahren • Kinostart: 24.04.2019 • Deutsche Website
Handlung
Nach Thanos' (Josh Brolin) vernichtendem Triumph, bei dem mit einem Fingerschnipsen die Hälfte aller Lebewesen im Universum ausgelöscht wurde, sind die übrig gebliebenen Avengers moralisch am Ende und von Schuldgefühlen über ihre erste große Niederlage erfüllt. Insbesondere am körperlich und psychisch angeschlagenen Tony Stark (Robert Downey Jr.) nagt das Gefühl des Versagens. Mit Unterstützung des mächtigen Neuankömmlings Captain Marvel (Brie Larson) unternehmen die dezimierten Avengers einen verzweifelten Versuch, alles wieder in Ordnung zu bringen. Als auch dieser nicht aufgeht, müssen sich die Helden mit der bitteren neuen Lebensrealität arrangieren. Manchen von ihnen gelingt das mit der Zeit besser als anderen, die alles verloren haben. Als jedoch Scott Lang alias Ant-Man (Paul Rudd) mit einer tollkühnen Idee am Avengers-Hauptquartier anklopft, schöpfen Natasha (Scarlett Johansson), Steve (Chris Evans) und Co erstmals wieder Hoffnung, die unbeschreibliche Katastrophe ungeschehen zu machen. Dazu muss jedoch die alte Truppe wieder zusammengetrommelt werden, denn der riskante Plan erfordert alle Mann an Deck. Nicht alle sind jedoch auf Anhieb überzeugt.
Kritik
"Avengers, assemble!"
Wenn dieser Satz in Avengers: Endgame ausgesprochen wird, wird Millionen von Fans der Marvel-Kinohelden weltweit das Herz vor unbändiger Freude springen, denn was darauf folgt, ist mit Sicherheit die epischste Szene des gesamten Marvel Cinematic Universe. So inflationär dieses Adjektiv bei Blockbustern auch benutzt wird, selten war es zutreffender, seit die Avengers in ihrem ersten gemeinsamen Film vor sieben Jahren einen Kreis bildeten.
Es ist nicht abwegig, das Marvel Cinematic Universe (MCU) mit seiner seriell aufeinander aufbauenden Handlung als eine Art ultrateure, im Kino gezeigte Serie, und ihre einzelnen Phasen als Staffeln zu betrachten. Auch wenn das MCU natürlich noch sehr lange fortbestehen wird und die aktuelle dritte Phase erst mit Spider-Man: Far From Home ihr offizielles Ende finden soll, fühlt sich Avengers: Endgame in dieser Analogie als das große Serienfinale an. Einige MCU-Filme sind natürlich besser als andere, doch man kann auch guten Gewissens sagen, dass die Qualität insgesamt auf einem hohen Niveau gehalten wurde und die Erwartungen immer wieder übertroffen wurden. Wie die meisten Serienfans wissen, kann ein enttäuschendes Finale auch bei einer ansonsten guten Serie einen so bitteren Nachgeschmack hinterlassen, dass sich dieser rückblickend auf den Rest der Serie abfärbt. Doch Disney, Marvel und das Regie-Duo Joe und Anthony Russo haben wieder einmal etwas geschafft, das im Vorfeld noch schwieriger erschien, als Thanos' Massenmord ungeschehen zu machen: Sie haben die himmelhohen Erwartungen erfüllt und ein äußerst zufriedenstellendes, kraftvolles Finale einer elfjährigen und 22 Filme starken Filmsaga bewerkstelligt.
 Doch es sind nicht der gebotene und zu erwartende Bombast und Spektakel, sondern die vielen kleinen Charaktermomente und Reminiszenzen, die Endgame zu einem nahezu perfekten Abschluss des bisherigen Marvel-Kinouniversums machen. Infinity War war eine wilde Achterbahnfahrt, die von einer rasanten Actionszene zur nächsten hetzte und dabei kaum Zeit zum Durchatmen ließ. So unterhaltsam er war, der Streifen fühlte sich wie ein zweieinhalbstündiger Showdown an. Trotz seines Titels gehörte die Geschichte von Infinity War nicht den Avengers, sondern Thanos, der sich zu einem der interessantesten MCU-Bösewichte entwickelt hat. Endgame ist hingegen ganz und gar seinen Helden gewidmet und erinnert die Zuschauer daran, weshalb das Marvel-Kinouniversum so beliebt ist. Denn dieses einzigartige ambitionierte Experiment eines gigantischen zusammenhängenden Filmuniversums mit mehr Hollywood-Stars als bei jeder Oscarverleihung ist nicht dank aufregender Action und atemberaubender Effekte aufgegangen, sondern dank der Charaktere, die die Kinogänger liebgewonnen haben. Wäre das MCU dort, wo es jetzt ist, wenn Robert Downey Jr.s Performance als Tony Stark vor elf Jahren nicht auf den Anklang gestoßen wäre, der ihr zuteilwurde? Vermutlich nicht.
Doch es sind nicht der gebotene und zu erwartende Bombast und Spektakel, sondern die vielen kleinen Charaktermomente und Reminiszenzen, die Endgame zu einem nahezu perfekten Abschluss des bisherigen Marvel-Kinouniversums machen. Infinity War war eine wilde Achterbahnfahrt, die von einer rasanten Actionszene zur nächsten hetzte und dabei kaum Zeit zum Durchatmen ließ. So unterhaltsam er war, der Streifen fühlte sich wie ein zweieinhalbstündiger Showdown an. Trotz seines Titels gehörte die Geschichte von Infinity War nicht den Avengers, sondern Thanos, der sich zu einem der interessantesten MCU-Bösewichte entwickelt hat. Endgame ist hingegen ganz und gar seinen Helden gewidmet und erinnert die Zuschauer daran, weshalb das Marvel-Kinouniversum so beliebt ist. Denn dieses einzigartige ambitionierte Experiment eines gigantischen zusammenhängenden Filmuniversums mit mehr Hollywood-Stars als bei jeder Oscarverleihung ist nicht dank aufregender Action und atemberaubender Effekte aufgegangen, sondern dank der Charaktere, die die Kinogänger liebgewonnen haben. Wäre das MCU dort, wo es jetzt ist, wenn Robert Downey Jr.s Performance als Tony Stark vor elf Jahren nicht auf den Anklang gestoßen wäre, der ihr zuteilwurde? Vermutlich nicht.
 Das ist den Machern von Endgame bewusst. Frei nach dem Motto "Der Weg ist das Ziel" würdigt ihr Film die Reise, die die Zuschauer über mehr als ein Jahrzehnt gemeinsam mit den Helden unternommen haben. Wie bei Avengers: Infinity War, der mit Thanos' Vernichtung des asgardischen Flüchtlingsschiffs begonnen hat, setzt auch die ruhige Eröffnungsszene von Endgame noch vor dem Marvel-Studios-Logo den Ton für die nächsten Stunden. In dieser treffen wir einen Charakter wieder, den viele in Infinity War vermisst haben, und das bedrückende Wiedersehen macht eins klar: Diesmal wird es persönlich.
Das ist den Machern von Endgame bewusst. Frei nach dem Motto "Der Weg ist das Ziel" würdigt ihr Film die Reise, die die Zuschauer über mehr als ein Jahrzehnt gemeinsam mit den Helden unternommen haben. Wie bei Avengers: Infinity War, der mit Thanos' Vernichtung des asgardischen Flüchtlingsschiffs begonnen hat, setzt auch die ruhige Eröffnungsszene von Endgame noch vor dem Marvel-Studios-Logo den Ton für die nächsten Stunden. In dieser treffen wir einen Charakter wieder, den viele in Infinity War vermisst haben, und das bedrückende Wiedersehen macht eins klar: Diesmal wird es persönlich.
Infinity War hatte die schwierige Aufgabe, zahlreiche Charaktere des MCU erstmals zusammenzuführen. Dabei war es unausweichlich, dass die meisten von ihnen zu kurz kamen. Indem jener Film jedoch den Großteil der Charaktere am Ende aus dem Spiel nahm, ermöglichte er Avengers: Endgame einen deutlichen Fokus auf die Kerngruppe, mit der alles begonnen hat, und ihre bisherigen Charakterbögen fortzuführen – und zum Teil abzuschließen. Mit anderen Worten: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson und Jeremy Renner gehören die besten Szenen des Films. Downey Jr. und Johansson, deren Figuren von ihrer Niederlage traumatisiert und von der Hoffnung auf eine zweite Chance getrieben sind, sind besser denn je und haben einige Szenen, die wirklich ans Herz gehen. Auch Renners Hawkeye macht seine Abwesenheit im Vorgänger mit dem besten Auftritt seiner Figur im MCU wieder wett. Doch den besten Eindruck hinterlässt Hemsworth als Thor, wie wir ihn zuvor noch nie gesehen haben. Wirklich. Ihm hat der Film nicht nur seine lustigsten Szenen zu verdanken, sondern eine der rührendsten. Seine Bromance mit Rocket blüht zudem weiter auf. Letztlich sind es jedoch alle sechs, die ihre Entwicklung als Team und als einzelne Figuren zeigen. Dabei gibt es auch schöne Parallelen zum ersten The-Avengers-Film, wenn die Truppe hier wieder einmal teilweise widerwillig für eine neue Mission zusammenkommen muss.
 Die dreistündige Laufzeit entschleunigt den Film gegenüber seinem Vorgänger, wobei man dies keineswegs mit einem zähen Tempo verwechseln sollte. Der Film hat keine Durchhänger, keine einzige überflüssige Szene. Vielmehr lässt er sich die nötige Zeit, um den neuen Status Quo der Figuren zu etablieren, um sie später auf jeweils eigene Abenteuer zu schicken. Es gelingt, auf vielen Elementen der vorigen Filme aufzubauen. Diverse kleinere Details werden wieder aufgegriffen und plötzlich wichtig, was wieder einmal davon zeugt, wie gut durchdacht Kevin Feiges Plan des Marvel-Universums ist. Es gibt einige zum Teil sehr überraschende Wiedersehen mit Schauspielern, mit denen man nicht mehr gerechnet hat. Erfreulicherweise sind das nicht allesamt Fanservice-Cameos, sondern einige dienen auch dazu, die Charaktere voranzubringen.
Die dreistündige Laufzeit entschleunigt den Film gegenüber seinem Vorgänger, wobei man dies keineswegs mit einem zähen Tempo verwechseln sollte. Der Film hat keine Durchhänger, keine einzige überflüssige Szene. Vielmehr lässt er sich die nötige Zeit, um den neuen Status Quo der Figuren zu etablieren, um sie später auf jeweils eigene Abenteuer zu schicken. Es gelingt, auf vielen Elementen der vorigen Filme aufzubauen. Diverse kleinere Details werden wieder aufgegriffen und plötzlich wichtig, was wieder einmal davon zeugt, wie gut durchdacht Kevin Feiges Plan des Marvel-Universums ist. Es gibt einige zum Teil sehr überraschende Wiedersehen mit Schauspielern, mit denen man nicht mehr gerechnet hat. Erfreulicherweise sind das nicht allesamt Fanservice-Cameos, sondern einige dienen auch dazu, die Charaktere voranzubringen.
Falls Ihr Euch nun fragt, wo bei dieser Analyse nun Thanos und Carol Danvers alias Captain Marvel bleiben, so haben beide zwar wichtige, aber zeitlich gar nicht so umfassende Auftritte im Film, wie man es vielleicht erwarten würde. Larson (mit stylischer neuer Frisur!) darf als Carol ihre enormen Kräfte unter Beweis stellen, die sie inzwischen sehr gut beherrscht. Ihre unausweichliche Konfrontation mit Thanos ist nicht lang, aber genau so cool, wie man es erwarten würde. Thanos selbst bleibt weiterhin ein respekteinflößender Gegner, doch seine besten Momente hatte er im letzten Film.
 Im Vorfeld gab es natürlich zahllose Theorien darüber, wie sich die Handlung von Avengers: Endgame abspielen würde. Auch wenn einige der beliebten Vermutungen nicht ganz daneben waren, hat der Film immer noch viele unvorhersehbare Elemente und Wendungen. Ergibt alles davon Sinn? Nicht wirklich, aber das wird höchstens bei den pingeligsten Zuschauern ins Gewicht fallen. Avengers: Endgame ist komplex, manchmal nicht ganz kohärent, sieht sich aber nicht als Puzzle zum Auseinanderpflücken, sondern als eine emotionale, wehmütige und vom Geist echter Kameradschaft und Freundschaft geprägte Reise mit Figuren, mit denen inzwischen eine ganze Generation von Filmfans aufgewachsen ist. In dieser Hinsicht ist der Film ein Triumph.
Im Vorfeld gab es natürlich zahllose Theorien darüber, wie sich die Handlung von Avengers: Endgame abspielen würde. Auch wenn einige der beliebten Vermutungen nicht ganz daneben waren, hat der Film immer noch viele unvorhersehbare Elemente und Wendungen. Ergibt alles davon Sinn? Nicht wirklich, aber das wird höchstens bei den pingeligsten Zuschauern ins Gewicht fallen. Avengers: Endgame ist komplex, manchmal nicht ganz kohärent, sieht sich aber nicht als Puzzle zum Auseinanderpflücken, sondern als eine emotionale, wehmütige und vom Geist echter Kameradschaft und Freundschaft geprägte Reise mit Figuren, mit denen inzwischen eine ganze Generation von Filmfans aufgewachsen ist. In dieser Hinsicht ist der Film ein Triumph.
Fazit
Die Einsätze sind höher denn je, doch Avengers: Endgame ist trotzdem ein ruhigerer Film als sein von einem Actionhöhepunkt zum nächsten hetzender Vorgänger Infinity War. In einer perfekten Balance zwischen schenkelklopfendem Humor, mitreißendem Spektakel, großen Emotionen und sanftem Wehmut, die sogar Thanos stolz machen würde, gelingt Endgame ein sehr befriedigender und zum Teil unvorhersehbarer Abschluss des bisherigen Marvel-Filmuniversums. Dabei besinnt sich der Film darauf, was das Franchise überhaupt erst erfolgreich gemacht hat: seine Charaktere und ihre Entwicklung, die konsequent fortgeführt wird. Dass die Handlung bei näherer Betrachtung einige Logiklöcher aufweist, fällt dabei wenig ins Gewicht.













 Natürlich darf die Frauenpower-Botschaft in Captain Marvel auch nicht fehlen. Diese ist etwas expliziter und vielleicht ungeschickter eingebunden als sie es idealerweise hätte sein können, doch sie hat durchaus nicht Unrecht und das Herz am rechten Fleck. Letztlich ist der Film ist weit entfernt von dem Feminismus-Propagandawerk, als welches einige Internet-Trolle ihn (ungesehen) darzustellen versuchen.
Natürlich darf die Frauenpower-Botschaft in Captain Marvel auch nicht fehlen. Diese ist etwas expliziter und vielleicht ungeschickter eingebunden als sie es idealerweise hätte sein können, doch sie hat durchaus nicht Unrecht und das Herz am rechten Fleck. Letztlich ist der Film ist weit entfernt von dem Feminismus-Propagandawerk, als welches einige Internet-Trolle ihn (ungesehen) darzustellen versuchen. Einer der größten Hinweise darauf, dass der Film vor den meisten anderen MCU-Beiträgen angesiedelt ist, ist natürlich Samuel L. Jacksons Auftritt als jüngerer und noch zweiäugiger Nick Fury. Jackson hat sichtlich Spaß daran, die Rolle des späteren S.H.I.E.L.D.-Leiters mal ganz anders zu spielen. Das ist noch nicht der obercoole, abgebrühte Nick Fury, den wir kennen. Hier ist er entspannter, begeisterungsfähiger und voller Staunen über die neue Welt, die sich ihm durch Carol offenbart und ihn zuweilen auch überfordert. Zwischen Jackson und Larson entwickelt sich lässig-ungezwungene Chemie, aus der sich etliche humorvolle Szenen ergeben. Wir erfahren auch, wie Fury sein Auge verloren hat, und die (nicht vorlagenkonforme) Antwort darauf werden vermutlich nur die wenigsten erahnen. Außerordentlich gelungen ist digitale Verjüngung um 25 Jahre. Zwar zeigten sich die Fortschritte in dieser Technik bereits in Marvels Ant-Man an Michael Douglas und
Einer der größten Hinweise darauf, dass der Film vor den meisten anderen MCU-Beiträgen angesiedelt ist, ist natürlich Samuel L. Jacksons Auftritt als jüngerer und noch zweiäugiger Nick Fury. Jackson hat sichtlich Spaß daran, die Rolle des späteren S.H.I.E.L.D.-Leiters mal ganz anders zu spielen. Das ist noch nicht der obercoole, abgebrühte Nick Fury, den wir kennen. Hier ist er entspannter, begeisterungsfähiger und voller Staunen über die neue Welt, die sich ihm durch Carol offenbart und ihn zuweilen auch überfordert. Zwischen Jackson und Larson entwickelt sich lässig-ungezwungene Chemie, aus der sich etliche humorvolle Szenen ergeben. Wir erfahren auch, wie Fury sein Auge verloren hat, und die (nicht vorlagenkonforme) Antwort darauf werden vermutlich nur die wenigsten erahnen. Außerordentlich gelungen ist digitale Verjüngung um 25 Jahre. Zwar zeigten sich die Fortschritte in dieser Technik bereits in Marvels Ant-Man an Michael Douglas und  Leider ist die entsprechende Verjüngung bei Clark Gregg als Phil Coulson weniger gelungen, der sich irgendwo zwischen Uncanny Valley und einer Botox-Überdosis bewegt. Auch sonst sind die Computereffekte bei Captain Marvel trotz einiger wirklich spektakulärer Bilder im Weltraum nicht ganz auf dem höchsten Niveau vieler anderer Marvel-Filme. Green-Screen-Aufnahmen machen sich gelegentlich bemerkbar. Das ist selbstverständlich Meckern auf hohem Niveau, doch die photorealistischen CGI-Effekte der letzten Jahre bestimmen eben die Erwartungshaltung.
Leider ist die entsprechende Verjüngung bei Clark Gregg als Phil Coulson weniger gelungen, der sich irgendwo zwischen Uncanny Valley und einer Botox-Überdosis bewegt. Auch sonst sind die Computereffekte bei Captain Marvel trotz einiger wirklich spektakulärer Bilder im Weltraum nicht ganz auf dem höchsten Niveau vieler anderer Marvel-Filme. Green-Screen-Aufnahmen machen sich gelegentlich bemerkbar. Das ist selbstverständlich Meckern auf hohem Niveau, doch die photorealistischen CGI-Effekte der letzten Jahre bestimmen eben die Erwartungshaltung. In seiner ersten Hälfte hat der Film einige Tempo-Durchhänger und die Charaktereinführung lässt etwas zu wünschen übrig. Obwohl Carol bereits Jahre unter den Kree verbracht hat, fehlt ein das Gespür dafür, wo ihr Platz in dieser Welt ist und wie sie sich darin integriert hat. Dieser Teil wird zu schnell abgehandelt, bevor sie auf die Erde kommt. Dann steigert sich der Film jedoch stetig, serviert mehrere mal mehr, mal weniger vorhersehbare Wendungen, und verdient sich dank seines sorgfältigen Aufbaus auch seinen fesselnden, actionreichen Höhepunkt im Finale. Das Regieduo Ryan Fleck und Anna Boden hinterlässt keinen erkennbar eigenen Stempel wie James Gunn in Guardians of the Galaxy, Ryan Coogler in
In seiner ersten Hälfte hat der Film einige Tempo-Durchhänger und die Charaktereinführung lässt etwas zu wünschen übrig. Obwohl Carol bereits Jahre unter den Kree verbracht hat, fehlt ein das Gespür dafür, wo ihr Platz in dieser Welt ist und wie sie sich darin integriert hat. Dieser Teil wird zu schnell abgehandelt, bevor sie auf die Erde kommt. Dann steigert sich der Film jedoch stetig, serviert mehrere mal mehr, mal weniger vorhersehbare Wendungen, und verdient sich dank seines sorgfältigen Aufbaus auch seinen fesselnden, actionreichen Höhepunkt im Finale. Das Regieduo Ryan Fleck und Anna Boden hinterlässt keinen erkennbar eigenen Stempel wie James Gunn in Guardians of the Galaxy, Ryan Coogler in  Eine wirklich positive Überraschung im Film ist Ben Mendelsohn als Talos. Der australische Schauspieler ist inzwischen Hollywoods neue erste Wahl für Schurkenrollen, nachdem Javier Bardem und Christoph Waltz diese Funktion in den letzten Jahren erfüllten. Doch obwohl Talos auf dem ersten Blick wie ein weiterer uninspirierter MCU-Bösewicht und eine stereotype Mendelsohn-spielt-böse-Performance à la Ready Player One oder
Eine wirklich positive Überraschung im Film ist Ben Mendelsohn als Talos. Der australische Schauspieler ist inzwischen Hollywoods neue erste Wahl für Schurkenrollen, nachdem Javier Bardem und Christoph Waltz diese Funktion in den letzten Jahren erfüllten. Doch obwohl Talos auf dem ersten Blick wie ein weiterer uninspirierter MCU-Bösewicht und eine stereotype Mendelsohn-spielt-böse-Performance à la Ready Player One oder  Doch während Larson der glänzende Stern des Films, Jackson die Identitätsfigur für die meisten Zuschauer und Mendelsohn ein sympathischer Widersacher ist, stiehlt ein Vierbeiner allen drei die Show. Carols Kater Goose, benannt nach Anthony Edwards' Charakter aus Top Gun, ist für einige der besten Szenen des Films verantwortlich, die sowohl allen Katzenliebhabern die Herzen höher schlagen lassen werden, als auch diejenigen Bestätigung finden lassen, die Katzen für hinterlistige Ausgeburten der Hölle halten. Die Zuschauer dürfen sich außerdem auf eins der cleversten Cameos (genau aufpassen!) der verstorbenen Marvel-Legende Stan Lee freuen. Ihm ist auch das neue Marvel-Studios-Logo gewidmet ist und man kann es einem nicht verübeln, wenn man als Fan in dem Moment nach den Taschentüchern greift.
Doch während Larson der glänzende Stern des Films, Jackson die Identitätsfigur für die meisten Zuschauer und Mendelsohn ein sympathischer Widersacher ist, stiehlt ein Vierbeiner allen drei die Show. Carols Kater Goose, benannt nach Anthony Edwards' Charakter aus Top Gun, ist für einige der besten Szenen des Films verantwortlich, die sowohl allen Katzenliebhabern die Herzen höher schlagen lassen werden, als auch diejenigen Bestätigung finden lassen, die Katzen für hinterlistige Ausgeburten der Hölle halten. Die Zuschauer dürfen sich außerdem auf eins der cleversten Cameos (genau aufpassen!) der verstorbenen Marvel-Legende Stan Lee freuen. Ihm ist auch das neue Marvel-Studios-Logo gewidmet ist und man kann es einem nicht verübeln, wenn man als Fan in dem Moment nach den Taschentüchern greift.

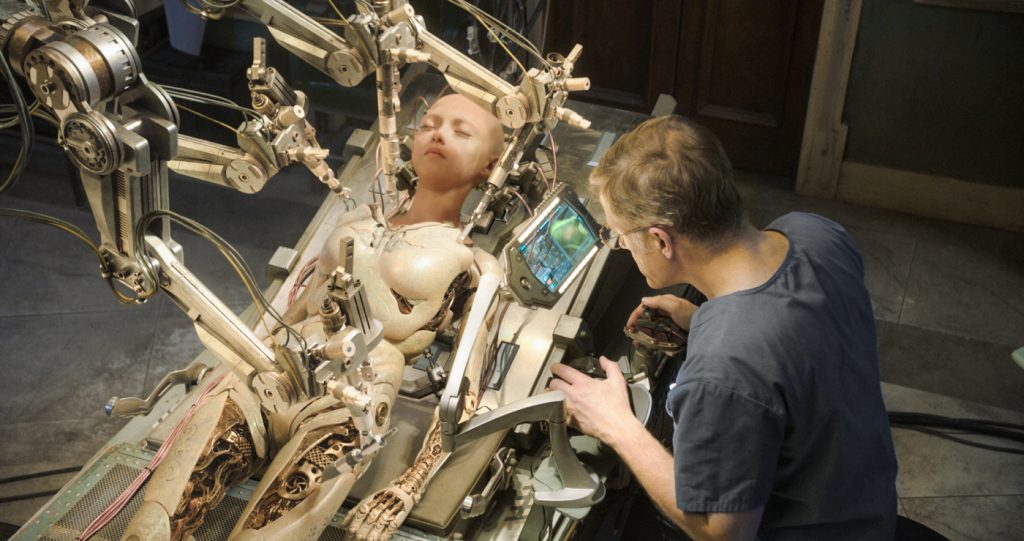




 Diese betreffen hauptsächlich die Figuren des Films – weitestgehend klar gezeichnete Stereotype. Taylor Russells Zoey ist ein verschlossenes Genie und muss im Verlauf des Films lernen, ihr mangelndes Selbstvertrauen zu überwinden. Als Jason ist Jay Ellis der klassisch arrogante, rücksichtslose Finanzhai. Bens (Logan Miller) Hang zum Alkohol wird durch das Bild eines Flachmanns auf seiner tristen Arbeit als Lagerist kommuniziert. Der sträflich unterforderte "True Blood"-Star Deborah Ann Woll gibt die traumatisierte Irak-Veteranin zum Besten. Tyler Labine als einfach gestrickter Trucker ist immerhin recht sympathisch und Nik Dodanis überschwänglich begeisterter Escape-Room-Fanatiker ist vor allem da, um den Zuschauern zu erklären, was Escape Rooms sind. Dabei sollte man meinen, dass wenn der Trend dieser simulierten Fluchtszenarien schon so groß ist, dass er bereits drei gleich betitelte Filme innerhalb von drei Jahren inspiriert hat, das Konzept keine zusätzliche Erklärung nötig hat. Ja, es gab 2017 sogar einen weiteren Film mit dem selben Titel, doch ihn habe ich (zum Glück?) nicht gesehen.
Diese betreffen hauptsächlich die Figuren des Films – weitestgehend klar gezeichnete Stereotype. Taylor Russells Zoey ist ein verschlossenes Genie und muss im Verlauf des Films lernen, ihr mangelndes Selbstvertrauen zu überwinden. Als Jason ist Jay Ellis der klassisch arrogante, rücksichtslose Finanzhai. Bens (Logan Miller) Hang zum Alkohol wird durch das Bild eines Flachmanns auf seiner tristen Arbeit als Lagerist kommuniziert. Der sträflich unterforderte "True Blood"-Star Deborah Ann Woll gibt die traumatisierte Irak-Veteranin zum Besten. Tyler Labine als einfach gestrickter Trucker ist immerhin recht sympathisch und Nik Dodanis überschwänglich begeisterter Escape-Room-Fanatiker ist vor allem da, um den Zuschauern zu erklären, was Escape Rooms sind. Dabei sollte man meinen, dass wenn der Trend dieser simulierten Fluchtszenarien schon so groß ist, dass er bereits drei gleich betitelte Filme innerhalb von drei Jahren inspiriert hat, das Konzept keine zusätzliche Erklärung nötig hat. Ja, es gab 2017 sogar einen weiteren Film mit dem selben Titel, doch ihn habe ich (zum Glück?) nicht gesehen. Für den Genuss und das Verständnis des Films ist das Wissen um die Funktionsweise von Escape Rooms ohnehin nicht notwendig. Escape Room steht in der Tradition der Cube– und Saw-Reihen, die noch vor dem großen Escape-Rooms-Boom entstanden sind und sogar dazu beigetragen haben. Auch in jenen Filmen mussten unglückselige Opfer Räumen mit perfiden Todesfallen entkommen. Im Gegensatz zu seinen Vorbildern setzt Escape Room nicht auf blutspritzende, explizite Gewaltdarstellungen, sondern auf Spannung und ausgefallene Sets.
Für den Genuss und das Verständnis des Films ist das Wissen um die Funktionsweise von Escape Rooms ohnehin nicht notwendig. Escape Room steht in der Tradition der Cube– und Saw-Reihen, die noch vor dem großen Escape-Rooms-Boom entstanden sind und sogar dazu beigetragen haben. Auch in jenen Filmen mussten unglückselige Opfer Räumen mit perfiden Todesfallen entkommen. Im Gegensatz zu seinen Vorbildern setzt Escape Room nicht auf blutspritzende, explizite Gewaltdarstellungen, sondern auf Spannung und ausgefallene Sets. Wie schon kürzlich bei Sonys anderem Horrorfilm
Wie schon kürzlich bei Sonys anderem Horrorfilm 














