About five years ago hardly any moviegoer has heard of Rebel Wilson. A minor, but very memorable role in the smash hit Bridesmaids brought her onto the Hollywood scene in 2011 and just one year later, she got her major breakthrough as outrageous and often inappropriate Fat Amy in Pitch Perfect, a hilarious, spirited movie that made a cappella cool, Anna Kendrick a billboard sensation with her rendition of "Cups" and Rebel Wilson a bona fide comedy star.
Prior to the release of the much-awaited sequel (which is every bit as fun as its predecessor), we had the opportunity to interview the wildly talented Australian actress and got her talking about difficult stunt work, women in comedies, Pitch Perfect 3 (!) and the hardships of working on network television. Enjoy!
Filmfutter: What did you think, when you found out there would be a second film?
Rebel Wilson: I was very happy. Cha-ching, cha-ching! (laughs) No, it is not all about the money. We had so much fun making the first one and we all became friends, so it was a no-brainer to come back and film another one. But there were a lot of expectations that came with the success of the first film. We felt the responsibility to deliver a worthy, funny follow-up.
FF: Fat Amy is a huge fan-favorite. Do you get a lot of your character’s lines quoted back at you in real life?
RW: Yeah, I do. “Horizontal running”, “mermaid dancing”, “don’t put me down for cardio”, my crystal meth joke. Because I love doing different jokes over several takes, I sometimes don’t even remember saying them because it was just a one-off, but then they make it into the movie and everyone starts remembering them.
FF: Is it annoying, when people constantly quote those lines to you or is it flattering?
RW: It’s very flattering, especially when it’s jokes that I came up with spontaneously and people repeat them. It shows that you’re on the right track.
FF: How much did you get to improvise in this film?
RW: Only two of us have been given complete free reign, myself and Adam DeVine, who plays Bumper. The other girls, even though they are experienced actresses, they are not professional comediennes and we don’t have the writer on the set. The majority of the time, they just stick to the script or they are trying to react to what we are saying. Especially poor Brittany (Snow) – I would always go at her and make jokes about her red hair and they don’t know what to say back, which I’m sure causes them trouble on some days. But sometimes they surprise you and come up with something that is really clever and witty. The script is always so funny anyway. I just like to keep things fresh and spontaneous.

FF: How did you discover that you have a talent for making people laugh?
RW: When I started, I thought I was going to be a serious actress like Dame Judi Dench. In my very first professional play with the Sidney Theatre Company, I thought I was playing a serious role. When I came on stage, people just started laughing. I got very offended and the more I tried to be serious and deliver my lines, the more people laughed. Almost from that one performance I realized that I have something that people like to laugh at, so I went with that. My trick to comedy ever since then was to try to play things for real as much as possible, but exaggerate certain elements, so it becomes comic.
FF: A lot of your humor is making fun of yourself. Does it ever hurt?
RW: No, not at all. I am always the first to make fun of myself because I feel that it then gives me a license to make fun of other people. Some actresses would be very offended if they had been offered the role of Fat Amy. I just look at it strategically, exploring the comic opportunities. To me it was the character that was the funniest, so I wanted to play her. I am a lot more sensible in real life than the characters I play. People are often shocked to find out that I have two degrees from university because I often play stupid characters. (laughs)
FF: Would you still say that you are similar to Fat Amy?
RW: Quite similar, yes, just a bit more sensible and less wild.
FF: You are a fan of American reality TV, right?
RW: Yeah. One of the reasons I watched these shows was to learn the accent. I didn’t think I would be playing Australians in movies, but now Rose Byrne is doing it a lot more and Chris Hemsworth also often uses his real voice. It didn’t use to be like that before, you had to be really American (imitates an over-the-top American accent). I do still love reality TV and I watch a lot of it. I have this favorite called “Dance Moms”, I love “Survivor”. I also used to watch “Here comes Honey Boo-Boo” (laughs). It actually reminded me a bit of my family, not in terms of what happened later, but in that they would also eat disgusting food. We weren’t very privileged in our upbringing.
FF: Was it difficult for a girl from Australia to break into the Hollywood system?
RW: My agency, WME, saw an Australian musical television series that I wrote, produced and starred in (“Bogan Pride”), signed me and I was incredibly lucky to be cast in Bridesmaids within three months. Compared to a lot of actors waiting for a break, it happened really quickly to me.
FF: As far as women in Hollywood are concerned, in comedy in particular, do you think there have been big strides in recent years and that women are finally getting more recognition in comedic roles?
RW: I mean, women have obviously always been doing comedy, although historically it is more acceptable to laugh at a guy than at a girl, so it can be harder for women, especially in stand-up. I was very lucky that my first job in America was in Bridesmaids. The huge success of that film launched the renaissance of female ensemble movies and now a lot is being developed in that direction and a lot of female screenwriters are being hired, whereas before it was 90% male screenwriters for comedies.
FF: You used to have a sitcom, “Super Fun Night” that was unfortunately cancelled after one season. What was your television experience like?
RW: I didn’t anticipate how difficult it would be to be the writer, producer and star on a network show in America because you do seven pages a day, which is a lot and on the weekends I was writing the next week’s episode. You get no time off. I have no idea how Tina Fey has done this for seven years on “30 Rock”. I had never worked in that system before and I was censored a lot. A lot of my favourite stuff was cut. It was cool, though. On the set of the third Night at the Museum, I actually spoke a lot to Robin Williams about how difficult it is to get interesting comedy out on network TV. He had a network TV show against mine (“The Crazy Ones”) at the time. It was a good experience, but if I did it again, I know what I would have done differently.
FF: Like going to cable?
RW: Yeah…I am actually getting a lot of cable offers, but at the moment movies are so much more fun, so I am writing and developing them.
FF: Elizabeth Banks also has great comedic talent and with Pitch Perfect 2 she transitioned to directing. Is that something that you aspire to one day or are you perfectly happy being an actress?
RW: I have been asked, but I don’t think I ever would. Writing is cool because it is a different side of your brain than acting, but I don’t think I want to be the captain of the ship. I love working for other people. Acting and writing is enough.

FF: Do you enjoy playing leading roles or supporting roles more?
RW: I am headlining most of the projects that are being developed with me right now, but when you are first coming up you just take whatever roles you can get. The characters that I like to play are usually the more eccentric side characters. So it has been interesting recently to develop movies, in which you are the lead.
FF: Barack Obama makes an appearance in the film, per archive footage. Did you really meet him?
RW: I have been to the White House Correspondents Dinner, but it’s not like we sat down and chatted. I know they are big fans of the movie. Michelle Obama sent me a letter after the first one and she invited us to perform at the White House, which unfortunately didn’t work out.
FF: What performance was the most challenging for you in the film?
RW: The aerial stunts were very challenging to the point that I didn’t think I would be able to do them. The death-drop move, where you swing yourself up and then drop was pretty hard. I don’t have any natural skills in that department. I do have good flexibility, which they tested before they agreed to do that part of the movie. I have trained for five weeks and done a lot of stretching. There will be a little documentary on the DVD about it.
FF: You have already signed on another sequel to Pitch Perfect, which will most likely happen if the second film is successful. Do you know if anyone else from the cast is supposed to come back?
RW: I have no idea, honestly. I am very flattered that they offered me a new contract. The new girls, Hailee (Steinfeld) and Chrissie (Fit), have been signed for two movies, but I don’t know about the other girls. I guess they’ll see how the fans react to this movie and then hopefully come up with a great premise for the third one.
FF: Where would you personally like to take Fat Amy in the franchise?
RW: I would like her to build an Australian team to go against America. (laughs) We were joking that we would enter intergalactic championships…
FF: Because that is the only way to progress from world championship, right?
RW: Exactly, how do you get bigger than that? Or we could do the world championship again. We should watch The Mighty Ducks 3 and see what they did. You know, there are a lot of structural similarities between Pitch Perfect and The Mighty Ducks.
FF: What do you have coming up next?
RW: I am in the new movie with Sacha Baron Cohen, called Grimsby, where I play his wife. It is very attention-seeking, I’ve got some very graphic content in that one. Sacha’s actual wife, Isla Fisher, also stars in it. We have some great scenes together. Penélope Cruz plays the villain and it was really cool to work with her. Then I have got Kung Fu Panda 3 coming up. After the press tour for Pitch Perfect 2, I’ll be filming How to Be Single with a German director, Christian Ditter and with Dakota Johnson from Fifty Shades of Grey.
FF: All of those are comedies. Do you plan to pursue dramatic roles in future as well?
RW: I am looking for a dramatic project, but it has to be really dramatic. I can’t do a half-hearted one, it’d confuse people. I have been looking for a very serious movie, but I haven’t found one yet.
FF: Thank you very much for your interview and good luck with your films!
by Arthur Awanesjan
__________________________________________________
More interviews about Pitch Perfect 2:
All images © 2015 Universal Pictures


 Kanada 2015: Eine Gesetzesänderung macht es möglich, elterliches Sorgerecht an den Staat abzutreten. Diane (Anne Dorval) will davon nichts wissen. Die Single-Mom ist mit ihrem Sohn Steve (Antoine-Oliver Pilon) überfordert, weil dieser an ADHS leidet und zu spontanen Gewaltausbrüchen neigt. Der ruhelos wirkende Sohn wird sogar gegenüber seiner Mutter gewalttätig, wenn irgendetwas ihn reizt. Diane versucht aufgewühlt, der Lage Herr zu werden und hofft auf die Mithilfe der Nachbarin Kyla (Suzanne Clément). Die krankgeschriebene Lehrerin bildet nun das dritte Stück in dem ungewöhnlichen Beziehungsdreieck dieser drei unterschiedlichen Charaktere. Jeder hat sein schweres Paket Probleme zu tragen und zu bewältigen. Vielleicht bekommt Diane endlich die Wertschätzung und Unterstützung, die ihr bisher von staatlicher und eigentlich jeglicher anderen Seite versagt blieb.
Kanada 2015: Eine Gesetzesänderung macht es möglich, elterliches Sorgerecht an den Staat abzutreten. Diane (Anne Dorval) will davon nichts wissen. Die Single-Mom ist mit ihrem Sohn Steve (Antoine-Oliver Pilon) überfordert, weil dieser an ADHS leidet und zu spontanen Gewaltausbrüchen neigt. Der ruhelos wirkende Sohn wird sogar gegenüber seiner Mutter gewalttätig, wenn irgendetwas ihn reizt. Diane versucht aufgewühlt, der Lage Herr zu werden und hofft auf die Mithilfe der Nachbarin Kyla (Suzanne Clément). Die krankgeschriebene Lehrerin bildet nun das dritte Stück in dem ungewöhnlichen Beziehungsdreieck dieser drei unterschiedlichen Charaktere. Jeder hat sein schweres Paket Probleme zu tragen und zu bewältigen. Vielleicht bekommt Diane endlich die Wertschätzung und Unterstützung, die ihr bisher von staatlicher und eigentlich jeglicher anderen Seite versagt blieb. „Mommy“ ist niemals moralisierendes, aufdringliches oder dokumentarisches Kino zum Zwecke der Aufklärung, wie es denn unten im sozialen Sediment so aussieht. Weit weg von einer Milieustudie, offenbart sich viel mehr eine brachiale Charakterexploration. Wie sollen Menschen einander helfen, wenn sie mit sich selbst nicht im Reinen sind? Wie soll man jemandem am Abgrund die Hand reichen, wenn man sie eigentlich selbst zum Hochklettern benötigt? Nun, diese Fragen stellen sich zwar, doch Dolan gewährt seinen Figuren so viel Freiraum, dass solche Fragen allerhöchstens ganz unprätentiös in den Köpfen der Zuschauer selbst entstehen, ebenso wie die Antworten darauf. Fließband-Passepartout gab und wird es bei Dolan (höchstwahrscheinlich) nicht geben. Solche Balanceakte stemmt der junge Regisseur aus dem Jahrgang 1989 wie ein versierter Hochseilkünstler. Wird eben noch mit schnellen Schnitten, Slow-Motion, übersättigten Farben und modernen Popsongs ein waschechtes Musikvideo präsentiert, kippt die freudige und ausgelassene Stimmung daheim wieder. Treffen die temperamentvolle Diane und der unbändige Steve unschön aufeinander, verfinstert sich die Szenerie blitzschnell. Dies gelingt ohne plastische Chirurgie beim Drehbuch; ein Beweis für gekonntes Autorenkino. Es ist sprachlich mal abscheulich, dann wieder wonnevoll. Antizipierendes Schauen ist genau so wenig möglich, wie das vorhersehbare Verhalten der Protagonisten. Dreckig und ungestüm wie die verrohte Sprache im Gegenpol zu beschwichtigenden Zuneigungsbekundungen und (teilweise falsch adressierter) süßer Zärtlichkeit.
„Mommy“ ist niemals moralisierendes, aufdringliches oder dokumentarisches Kino zum Zwecke der Aufklärung, wie es denn unten im sozialen Sediment so aussieht. Weit weg von einer Milieustudie, offenbart sich viel mehr eine brachiale Charakterexploration. Wie sollen Menschen einander helfen, wenn sie mit sich selbst nicht im Reinen sind? Wie soll man jemandem am Abgrund die Hand reichen, wenn man sie eigentlich selbst zum Hochklettern benötigt? Nun, diese Fragen stellen sich zwar, doch Dolan gewährt seinen Figuren so viel Freiraum, dass solche Fragen allerhöchstens ganz unprätentiös in den Köpfen der Zuschauer selbst entstehen, ebenso wie die Antworten darauf. Fließband-Passepartout gab und wird es bei Dolan (höchstwahrscheinlich) nicht geben. Solche Balanceakte stemmt der junge Regisseur aus dem Jahrgang 1989 wie ein versierter Hochseilkünstler. Wird eben noch mit schnellen Schnitten, Slow-Motion, übersättigten Farben und modernen Popsongs ein waschechtes Musikvideo präsentiert, kippt die freudige und ausgelassene Stimmung daheim wieder. Treffen die temperamentvolle Diane und der unbändige Steve unschön aufeinander, verfinstert sich die Szenerie blitzschnell. Dies gelingt ohne plastische Chirurgie beim Drehbuch; ein Beweis für gekonntes Autorenkino. Es ist sprachlich mal abscheulich, dann wieder wonnevoll. Antizipierendes Schauen ist genau so wenig möglich, wie das vorhersehbare Verhalten der Protagonisten. Dreckig und ungestüm wie die verrohte Sprache im Gegenpol zu beschwichtigenden Zuneigungsbekundungen und (teilweise falsch adressierter) süßer Zärtlichkeit. Mit „Mommy“ ist es wie mit einem Strauß Blumen. Oftmals sagt die Geste mehr als 1000 Worte. Xavier Dolan braucht sich zwar keineswegs hinter seinen Dialogen zu verstecken, doch sagen seine Bildkompositionen manchmal mehr als das gesprochene Wort, denn er versteht es, wann lediglich gezeigt werden muss. „Gezeigt“ meint allerdings auch nicht „entblößt“. Missratene therapeutische Lehrstunden gibt es für das Publikum nicht. Diese gibt es in einzelnen Szenen für das fragile Dreigestirn um Kyla, Diane und Steve. Beispielhaft ist der Moment, bei welchem Steve versucht, Kyla auf respektlose und herablassende Art und Weise anzubaggern. Sie reagiert daraufhin mit unverhohlener, ehrlicher Aggression. Eine menschliche und nachvollziehbare Reaktion, während der Pädagoge in einem das Näschen kraus zieht. Dennoch ist es gerecht: Ein Dämpfer für den Wuschelkopf, der hin- und hergerissen ist, zwischen bedürftiger Zuneigung, Jähzorn und sich als Spielball seiner und der Launen anderer präsentiert. Die Gefühlswelten der Figuren sind darüber hinaus noch komplexer als gesagt oder gezeigt wird. Der Film fordert ein Fine-Tuning der Sinne, wenn es darum geht, auch ganz flüchtige Nuancen zu deuten. Fährt Steve mit seinem Longboard und alles abschirmenden Kopfhörern durch die Straßen, fällt auf, dass sein hektischer Flow nicht zum Mid-Tempo-Takt des Filmsoundtracks passt. Somit ist auch das Augenscheinliche vielleicht nur ein Bollwerk aus Selbstschutzmechanismen und Bewältigungsstrategien. Die Trennschärfe zwischen Gegensätzlichkeit ist allemal ein Hauch, doch dieser brennt umso intensiver im Gesicht, wenn man sich diesem Film offenbart.
Mit „Mommy“ ist es wie mit einem Strauß Blumen. Oftmals sagt die Geste mehr als 1000 Worte. Xavier Dolan braucht sich zwar keineswegs hinter seinen Dialogen zu verstecken, doch sagen seine Bildkompositionen manchmal mehr als das gesprochene Wort, denn er versteht es, wann lediglich gezeigt werden muss. „Gezeigt“ meint allerdings auch nicht „entblößt“. Missratene therapeutische Lehrstunden gibt es für das Publikum nicht. Diese gibt es in einzelnen Szenen für das fragile Dreigestirn um Kyla, Diane und Steve. Beispielhaft ist der Moment, bei welchem Steve versucht, Kyla auf respektlose und herablassende Art und Weise anzubaggern. Sie reagiert daraufhin mit unverhohlener, ehrlicher Aggression. Eine menschliche und nachvollziehbare Reaktion, während der Pädagoge in einem das Näschen kraus zieht. Dennoch ist es gerecht: Ein Dämpfer für den Wuschelkopf, der hin- und hergerissen ist, zwischen bedürftiger Zuneigung, Jähzorn und sich als Spielball seiner und der Launen anderer präsentiert. Die Gefühlswelten der Figuren sind darüber hinaus noch komplexer als gesagt oder gezeigt wird. Der Film fordert ein Fine-Tuning der Sinne, wenn es darum geht, auch ganz flüchtige Nuancen zu deuten. Fährt Steve mit seinem Longboard und alles abschirmenden Kopfhörern durch die Straßen, fällt auf, dass sein hektischer Flow nicht zum Mid-Tempo-Takt des Filmsoundtracks passt. Somit ist auch das Augenscheinliche vielleicht nur ein Bollwerk aus Selbstschutzmechanismen und Bewältigungsstrategien. Die Trennschärfe zwischen Gegensätzlichkeit ist allemal ein Hauch, doch dieser brennt umso intensiver im Gesicht, wenn man sich diesem Film offenbart. • Interviews mit Xavier Dolan, Antoine Olivier Pilon, Suzanne Clément
• Interviews mit Xavier Dolan, Antoine Olivier Pilon, Suzanne Clément



 Ihre Leidenschaft ist das Kochen. Chefkoch Carl Casper (Jon Favreau) und seine Mit-Köche Martin (John Leguizamo) und Tony (Bobby Cannavale) arbeiten für den Restaurantbesitzer Riva (Dustin Hoffman), der leider nur kreativlose Speisekarten runterkochen lässt. Früher waren Kritiker von Carl Casper mehr als angetan, doch als ein Star-Food-Blogger (Oliver Platt) Caspers Kochkunst im Internet verreißt, kündigt Casper mit einer Schimpftirade, die prompt im Internet landet. Schlimmer noch: Er äußert sich unglücklich via Twitter dazu. Der Ex-Freund seiner Ex-Frau (Sofía Vergara) namens Martin (Robert Downey Jr.) ist ein blasiertes Schlitzohr und überreicht Carl einen versifften Imbisswagen. Dieser wird aufgemotzt und Freunde als auch Familie packen bald alle mit an. Carl nimmt seinen Sohn Percy (Emjay Anthony) zusammen mit seinen Koch-Kumpels mit auf einen Road Trip durch die südlichen USA. Dabei kocht er sich von Stadt zu Stadt wieder in die Herzen der Kunden und kann vielleicht das Verhältnis zu Sohn und Ex-Frau aufpolieren.
Ihre Leidenschaft ist das Kochen. Chefkoch Carl Casper (Jon Favreau) und seine Mit-Köche Martin (John Leguizamo) und Tony (Bobby Cannavale) arbeiten für den Restaurantbesitzer Riva (Dustin Hoffman), der leider nur kreativlose Speisekarten runterkochen lässt. Früher waren Kritiker von Carl Casper mehr als angetan, doch als ein Star-Food-Blogger (Oliver Platt) Caspers Kochkunst im Internet verreißt, kündigt Casper mit einer Schimpftirade, die prompt im Internet landet. Schlimmer noch: Er äußert sich unglücklich via Twitter dazu. Der Ex-Freund seiner Ex-Frau (Sofía Vergara) namens Martin (Robert Downey Jr.) ist ein blasiertes Schlitzohr und überreicht Carl einen versifften Imbisswagen. Dieser wird aufgemotzt und Freunde als auch Familie packen bald alle mit an. Carl nimmt seinen Sohn Percy (Emjay Anthony) zusammen mit seinen Koch-Kumpels mit auf einen Road Trip durch die südlichen USA. Dabei kocht er sich von Stadt zu Stadt wieder in die Herzen der Kunden und kann vielleicht das Verhältnis zu Sohn und Ex-Frau aufpolieren. Willkommen beim Seminar „Social Media Marketing für Dummies“. Leider muss das dauernde Twitter-Gezwitscher erneut erwähnt werden, um den nervigen Überfluss zu verdeutlichen. Aber nun zu weiteren Gedanken: Der schale Beigeschmack bleibt irgendwie ständig erhalten. Will Jon Favreau auf der einen Seite die erdrückenden Fesseln des Künstlers zeigen, wenn er sich den Vorgaben und Konventionen von Arbeitgebern bzw. Geldgebern unterwerfen muss, so präsentiert er uns einen dermaßen abgerundeten Film ohne Ecken und Kanten, als würde er sichergehen wollen, dass seine Sponsoren mit dem Film nicht auch nur einen Millimeter um den Mainstream-Fraß herumessen. Diese Parabel auf Independent-Filme (oder überhaupt irgendwas Indie-mäßiges) erstickt sich somit selbst, bevor sie eine Wirkung entfalten kann. Zu einfach und konform sind ebenfalls die Antworten gestrickt, wenn es darum geht, eine zerrüttete Ehe zu kitten oder ein sich anbahnendes Entfremden zum Sohnemann abzuwenden. Mach etwas, wo du gut drin bist und der restliche Himmel klart auch auf. Ob Ich-AG wirklich die Abkürzung zum Glück ist, bleibt fraglich, da sie hier als Allzweckwaffe vorgeschlagen wird.
Willkommen beim Seminar „Social Media Marketing für Dummies“. Leider muss das dauernde Twitter-Gezwitscher erneut erwähnt werden, um den nervigen Überfluss zu verdeutlichen. Aber nun zu weiteren Gedanken: Der schale Beigeschmack bleibt irgendwie ständig erhalten. Will Jon Favreau auf der einen Seite die erdrückenden Fesseln des Künstlers zeigen, wenn er sich den Vorgaben und Konventionen von Arbeitgebern bzw. Geldgebern unterwerfen muss, so präsentiert er uns einen dermaßen abgerundeten Film ohne Ecken und Kanten, als würde er sichergehen wollen, dass seine Sponsoren mit dem Film nicht auch nur einen Millimeter um den Mainstream-Fraß herumessen. Diese Parabel auf Independent-Filme (oder überhaupt irgendwas Indie-mäßiges) erstickt sich somit selbst, bevor sie eine Wirkung entfalten kann. Zu einfach und konform sind ebenfalls die Antworten gestrickt, wenn es darum geht, eine zerrüttete Ehe zu kitten oder ein sich anbahnendes Entfremden zum Sohnemann abzuwenden. Mach etwas, wo du gut drin bist und der restliche Himmel klart auch auf. Ob Ich-AG wirklich die Abkürzung zum Glück ist, bleibt fraglich, da sie hier als Allzweckwaffe vorgeschlagen wird.

 Die Charaktere von The Pyramid haben offensichtlich nie Die Mumie, The Descent oder andere ähnlich gelagerte Genrefilme gesehen, wenn sie es für eine gute Idee halten, eine seltsame, unerforschte Pyramide zu betreten, aus der kürzlich eine hochgradig giftige Schimmelpilzwolke ausgetreten ist. Erstlingsregisseur Grégory Levasseur hat hingegen viele solcher Filme gesehen und bedient sich schamlos bei allen davon. Das ist an sich auch nicht unbedingt ein Manko, schließlich kann nicht jeder Horrorfilm das Rad neu erfinden. Jedoch ist auch das gelungene Zusammenklauen von Versatzstücken anderer Filme eine Kunst, die Monsieur Levasseur noch erlernen muss. Reichlich Erfahrungen im Horrorgenre hat er als Alexandre Ajas Co-Autor von High Tension, The Hills Have Eyes, Mirrors und Piranha 3D gesammelt, ebenso wie als Autor und Produzent von P2 und
Die Charaktere von The Pyramid haben offensichtlich nie Die Mumie, The Descent oder andere ähnlich gelagerte Genrefilme gesehen, wenn sie es für eine gute Idee halten, eine seltsame, unerforschte Pyramide zu betreten, aus der kürzlich eine hochgradig giftige Schimmelpilzwolke ausgetreten ist. Erstlingsregisseur Grégory Levasseur hat hingegen viele solcher Filme gesehen und bedient sich schamlos bei allen davon. Das ist an sich auch nicht unbedingt ein Manko, schließlich kann nicht jeder Horrorfilm das Rad neu erfinden. Jedoch ist auch das gelungene Zusammenklauen von Versatzstücken anderer Filme eine Kunst, die Monsieur Levasseur noch erlernen muss. Reichlich Erfahrungen im Horrorgenre hat er als Alexandre Ajas Co-Autor von High Tension, The Hills Have Eyes, Mirrors und Piranha 3D gesammelt, ebenso wie als Autor und Produzent von P2 und  So inkonsistent die Genreausrichtung von The Pyramid ist, so uneinheitlich ist auch seine Präsentation. Anfangs hat man das Gefühl, wieder in einem "Found Footage"-Film zu stecken. Neben dem dafür obligatorischen Kamerateam werden auch die Archäologen bequemerweise mit am Kopf angebrachten Kameras ausgestattet. Doch man wird das Gefühl nicht los, dass Levasseur selbst mit dem Ansatz ganz und gar nicht glücklich ist und es dauert nicht lange, bis mit diesem ohne Erklärung gebrochen wird und wir Einstellungen bekommen, die eindeutig nicht von irgendwessen getragener Kamera stammen. Diese wiederholen sich so häufig, dass von einem Ausrutscher nicht die Rede sein kann. Dann muss man sich aber fragen, warum die Zuschauer trotzdem die Hälfte des Films durch Wackelkamera und Ich-Perspektive sehen müssen. Nicht etwa, um mittelmäßige Computereffekte zu kaschieren, oder? Diese erinnern nämlich ab einem gewissen Punkt an eine Eigenproduktion des SyFy-Channels à la Mongolian Death Worm oder die Lake-Placid-Sequels. Überhaupt fühlt sich der gesamte Film, einschließlich seiner Besetzung, sehr nach SyFy an und mit jeder verstreichenden Minute fragt man sich, wie er sich überhaupt einen Kino-Release sichern konnte.
So inkonsistent die Genreausrichtung von The Pyramid ist, so uneinheitlich ist auch seine Präsentation. Anfangs hat man das Gefühl, wieder in einem "Found Footage"-Film zu stecken. Neben dem dafür obligatorischen Kamerateam werden auch die Archäologen bequemerweise mit am Kopf angebrachten Kameras ausgestattet. Doch man wird das Gefühl nicht los, dass Levasseur selbst mit dem Ansatz ganz und gar nicht glücklich ist und es dauert nicht lange, bis mit diesem ohne Erklärung gebrochen wird und wir Einstellungen bekommen, die eindeutig nicht von irgendwessen getragener Kamera stammen. Diese wiederholen sich so häufig, dass von einem Ausrutscher nicht die Rede sein kann. Dann muss man sich aber fragen, warum die Zuschauer trotzdem die Hälfte des Films durch Wackelkamera und Ich-Perspektive sehen müssen. Nicht etwa, um mittelmäßige Computereffekte zu kaschieren, oder? Diese erinnern nämlich ab einem gewissen Punkt an eine Eigenproduktion des SyFy-Channels à la Mongolian Death Worm oder die Lake-Placid-Sequels. Überhaupt fühlt sich der gesamte Film, einschließlich seiner Besetzung, sehr nach SyFy an und mit jeder verstreichenden Minute fragt man sich, wie er sich überhaupt einen Kino-Release sichern konnte. Die fünf Hauptcharaktere bleiben allesamt recht blass und uninteressant. Denis O’Hare, ein zweifelsohne begnadeter Schauspieler (als Bösewicht in "True Blood" war er großartig), sieht als, als würde er sich den Tod seiner Figur möglichst schnell herbeiwünschen. Ashley Hinshaws größte Leistung besteht darin, ein Tank-Top ohne BH zu tragen und beim Umziehen von WALL-E gefilmt zu werden, damit auch der obligatorische heiße-Blondine-Quote eines Horrorfilms erfüllt wird. Zusammen bilden die beiden das inkompetenteste Archäologen-Paar der jüngsten Filmgeschichte und tragen ihre Ausführungen zur ägyptischen Mythologie und zum Pyramidenbau so desinteressiert vor, als würden sie aus dem Telefonbuch vorlesen. Ähnlich wenig überzeugend ist auch die Reaktion der Beteiligten auf bedrohliche und potenziell lebensgefährliche Situationen. „Es ist nicht sicher hier. Wir müssen hier weg“ stellt der Kameramann mit ähnlichem Enthusiasmus fest, als wären sie gerade unerwartet in den Regen geraten und würden nicht in einer ausweglosen Situation unter der Erde mit einem blutrünstigen Wesen und tückischen Fallen feststecken. Die wiederholte Betonung, es würde darin nach Exkrementen stinken, wirkt schon beinahe als Meta-Selbstironie, doch so viel Cleverness traue ich den Machern leider nicht zu.
Die fünf Hauptcharaktere bleiben allesamt recht blass und uninteressant. Denis O’Hare, ein zweifelsohne begnadeter Schauspieler (als Bösewicht in "True Blood" war er großartig), sieht als, als würde er sich den Tod seiner Figur möglichst schnell herbeiwünschen. Ashley Hinshaws größte Leistung besteht darin, ein Tank-Top ohne BH zu tragen und beim Umziehen von WALL-E gefilmt zu werden, damit auch der obligatorische heiße-Blondine-Quote eines Horrorfilms erfüllt wird. Zusammen bilden die beiden das inkompetenteste Archäologen-Paar der jüngsten Filmgeschichte und tragen ihre Ausführungen zur ägyptischen Mythologie und zum Pyramidenbau so desinteressiert vor, als würden sie aus dem Telefonbuch vorlesen. Ähnlich wenig überzeugend ist auch die Reaktion der Beteiligten auf bedrohliche und potenziell lebensgefährliche Situationen. „Es ist nicht sicher hier. Wir müssen hier weg“ stellt der Kameramann mit ähnlichem Enthusiasmus fest, als wären sie gerade unerwartet in den Regen geraten und würden nicht in einer ausweglosen Situation unter der Erde mit einem blutrünstigen Wesen und tückischen Fallen feststecken. Die wiederholte Betonung, es würde darin nach Exkrementen stinken, wirkt schon beinahe als Meta-Selbstironie, doch so viel Cleverness traue ich den Machern leider nicht zu.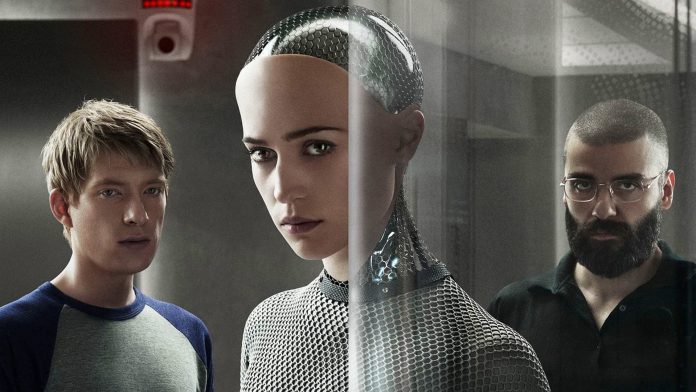

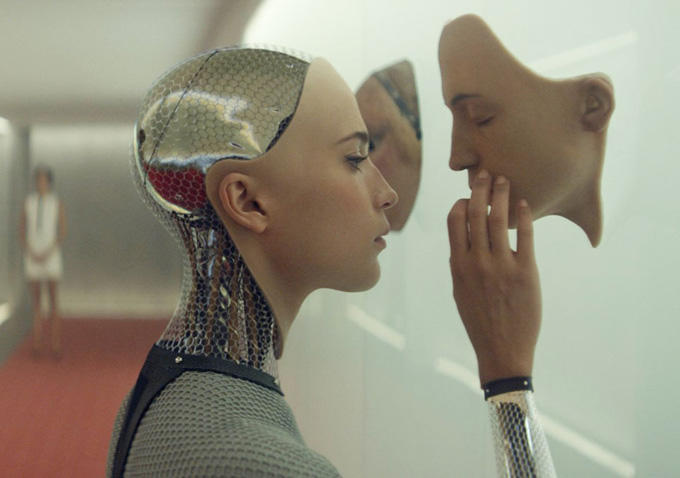


 X-Men 2, Spider-Man 2, The Dark Knight – bei großen Superhelden-Franchises ist es schon fast Tradition, dass der zweite Film seinen Vorgänger übertrifft und fast immer den Höhepunkt der Reihe darstellt. Avengers: Age of Ultron reiht sich perfekt in die Auflistung ein, denn Joss Whedon hat nicht nur ein Sequel abgeliefert, das dem typischen Hollywood-Muster entsprechend größer, lauter, actionreicher und vollgepackter mit Charakteren ist, sondern er hat auch den Balanceakt zwischen den zahlreichen Elementen des Films perfekt hinbekommen. Schon beim ersten Film war die Herausforderung enorm, ein über fünf Einzelfilme vorbereitetes Superhelden-Ensemble zusammenzubringen und dabei trotz unterschiedlicher Kräfte und Fan-Beliebtheit allen Figuren gerecht zu werden. Diese Aufgabe meisterte Whedon, mit einigen Abstrichen, wirklich gut. Seitdem ist das Marvel Cinematic Universe gewachsen und die Ansprüche der Fans damit auch. Der unerwartet düstere, harte und politisch gefärbte Einschlag von The Return of the First Avenger und der anarchische Humor von Guardians of the Galaxy konnten letztes Jahr kaum unterschiedlicher sein und doch hoben beide auf ihre Weise die Messlatte für Marvel-Filme höher. Man kann nicht behaupten, Age of Ultron würde dies auch machen, doch der Film repräsentiert perfekt die ehrgeizigere und bessere Phase Zwei von Marvel, die mit Ant-Man diesen Sommer ihren Abschluss finden wird.
X-Men 2, Spider-Man 2, The Dark Knight – bei großen Superhelden-Franchises ist es schon fast Tradition, dass der zweite Film seinen Vorgänger übertrifft und fast immer den Höhepunkt der Reihe darstellt. Avengers: Age of Ultron reiht sich perfekt in die Auflistung ein, denn Joss Whedon hat nicht nur ein Sequel abgeliefert, das dem typischen Hollywood-Muster entsprechend größer, lauter, actionreicher und vollgepackter mit Charakteren ist, sondern er hat auch den Balanceakt zwischen den zahlreichen Elementen des Films perfekt hinbekommen. Schon beim ersten Film war die Herausforderung enorm, ein über fünf Einzelfilme vorbereitetes Superhelden-Ensemble zusammenzubringen und dabei trotz unterschiedlicher Kräfte und Fan-Beliebtheit allen Figuren gerecht zu werden. Diese Aufgabe meisterte Whedon, mit einigen Abstrichen, wirklich gut. Seitdem ist das Marvel Cinematic Universe gewachsen und die Ansprüche der Fans damit auch. Der unerwartet düstere, harte und politisch gefärbte Einschlag von The Return of the First Avenger und der anarchische Humor von Guardians of the Galaxy konnten letztes Jahr kaum unterschiedlicher sein und doch hoben beide auf ihre Weise die Messlatte für Marvel-Filme höher. Man kann nicht behaupten, Age of Ultron würde dies auch machen, doch der Film repräsentiert perfekt die ehrgeizigere und bessere Phase Zwei von Marvel, die mit Ant-Man diesen Sommer ihren Abschluss finden wird. Natürlich hat Age of Ultron auch insofern einen Vorteil gegenüber seinem Vorgänger, da das Team nicht erst zusammengebracht werden muss. Die Phase, in der sich die Avengers-Initiative im ersten Film geformt wird, die Figuren ihre Differenzen (größtenteils) überwinden und sich endlich der gemeinsamen Bedrohung stellen, war zweifelsohne notwendig und auch gut umgesetzt, doch es hat schon was, dass der zweite Film direkt mit einer fantastischen Actionszene loslegt, in der man die Avengers als ein mittlerweile gut eingespieltes Team zusammenarbeiten sieht. Von da an legt der Streifen ein hohes Tempo an den Tag, gibt dem Zuschauer immer wieder gerade genug Zeit zum Durchatmen, bevor die nächste elaborierte und visuell makellos umgesetzte Actionszene einsetzt. Die Laufzeit, die lediglich zwei Minuten unter dem ersten Film liegt, vergeht hier auch bei wiederholtem Anschauen wie im Flug. Die Action bleibt strikt comichaft, die Helden sind fast nie ernsthafter Gefahr ausgesetzt und Tony rutscht natürlich ein flotter Spruch nach dem anderen über die Lippen (diesmal vor allem auf die Kosten von Cap). Jede Figur kommt dazu, ihre Stärken beeindruckend einzusetzen, entweder einzeln oder gemeinsam – es stellt sich heraus, dass Thors Hammer und Captain Americas Schild sich perfekt ergänzen. Auch wenn der Film immer wieder etwas düsterer wird, wird es nie zu ernst. Schließlich ist es nicht Nolans oder Snyders Universum und darin will Whedon auch gar nicht sein.
Natürlich hat Age of Ultron auch insofern einen Vorteil gegenüber seinem Vorgänger, da das Team nicht erst zusammengebracht werden muss. Die Phase, in der sich die Avengers-Initiative im ersten Film geformt wird, die Figuren ihre Differenzen (größtenteils) überwinden und sich endlich der gemeinsamen Bedrohung stellen, war zweifelsohne notwendig und auch gut umgesetzt, doch es hat schon was, dass der zweite Film direkt mit einer fantastischen Actionszene loslegt, in der man die Avengers als ein mittlerweile gut eingespieltes Team zusammenarbeiten sieht. Von da an legt der Streifen ein hohes Tempo an den Tag, gibt dem Zuschauer immer wieder gerade genug Zeit zum Durchatmen, bevor die nächste elaborierte und visuell makellos umgesetzte Actionszene einsetzt. Die Laufzeit, die lediglich zwei Minuten unter dem ersten Film liegt, vergeht hier auch bei wiederholtem Anschauen wie im Flug. Die Action bleibt strikt comichaft, die Helden sind fast nie ernsthafter Gefahr ausgesetzt und Tony rutscht natürlich ein flotter Spruch nach dem anderen über die Lippen (diesmal vor allem auf die Kosten von Cap). Jede Figur kommt dazu, ihre Stärken beeindruckend einzusetzen, entweder einzeln oder gemeinsam – es stellt sich heraus, dass Thors Hammer und Captain Americas Schild sich perfekt ergänzen. Auch wenn der Film immer wieder etwas düsterer wird, wird es nie zu ernst. Schließlich ist es nicht Nolans oder Snyders Universum und darin will Whedon auch gar nicht sein.
 Zum Glück kommt aber auch keiner der Avengers zu kurz – im Gegenteil, gerade auf die beiden weniger übermächtigen Rächer, Black Widow und Hawkeye, wird noch mehr eingegangen. Johanssons Figur erhält eine tragische Seite und Fans von Renners Hawkeye können sich darauf freuen, dass nachdem er für den Großteil des ersten Films aus dem Spiel war, er in Age of Ultron nicht nur zu einem vollwertigen und unentbehrlichen Mitglied des Teams wird, sondern auch unerwartet zu einem der interessantesten und menschlichsten Charaktere des Ensembles, der in einem kurzen Meta-Moment gegen Ende des Films den Reiz beschreibt, denn die albernen und zugleich saucoolen Marvel-Filme ausmachen. Mark Ruffalo glänzt abermals sowohl als gequälter Bruce Banner, für den sich ebenfalls neue Perspektive auftun als auch als Hulk, der wieder einmal eine wirklich glänzende Szene hat.
Zum Glück kommt aber auch keiner der Avengers zu kurz – im Gegenteil, gerade auf die beiden weniger übermächtigen Rächer, Black Widow und Hawkeye, wird noch mehr eingegangen. Johanssons Figur erhält eine tragische Seite und Fans von Renners Hawkeye können sich darauf freuen, dass nachdem er für den Großteil des ersten Films aus dem Spiel war, er in Age of Ultron nicht nur zu einem vollwertigen und unentbehrlichen Mitglied des Teams wird, sondern auch unerwartet zu einem der interessantesten und menschlichsten Charaktere des Ensembles, der in einem kurzen Meta-Moment gegen Ende des Films den Reiz beschreibt, denn die albernen und zugleich saucoolen Marvel-Filme ausmachen. Mark Ruffalo glänzt abermals sowohl als gequälter Bruce Banner, für den sich ebenfalls neue Perspektive auftun als auch als Hulk, der wieder einmal eine wirklich glänzende Szene hat. Ein weiterer großer Verdienst des Films ist es, dass sich ihn ihm das fast schon überbordernd große Marvel-Universum kohärent anfühlt. Zahlreiche Charaktere aus diversen MCU-Filmen neben den Hauptakteuren haben hier und da einen Auftritt – manche erwartet, andere etwas weniger, je nachdem, wie viel man sich im Vorfeld informiert hat. Wer sich nicht blicken lässt, wird zumindest namentlich erwähnt. Wer gut aufpasst, merkt, dass Whedon nicht nur vorangegangene Ereignisse würdigt, sondern auch geschickt das Fundament für einige der bereits angekündigten Marvel-Filme legt, ohne dass man sich jedoch aus der Haupthandlung herausgerissen fühlt. Lob gebührt an dieser Stelle der Marketing-Abteilung von Disney, denn die Trailer verraten diesmal im Vorfeld eigentlich recht wenig, sodass der Film einige gelungene und überraschende Wendungen bietet.
Ein weiterer großer Verdienst des Films ist es, dass sich ihn ihm das fast schon überbordernd große Marvel-Universum kohärent anfühlt. Zahlreiche Charaktere aus diversen MCU-Filmen neben den Hauptakteuren haben hier und da einen Auftritt – manche erwartet, andere etwas weniger, je nachdem, wie viel man sich im Vorfeld informiert hat. Wer sich nicht blicken lässt, wird zumindest namentlich erwähnt. Wer gut aufpasst, merkt, dass Whedon nicht nur vorangegangene Ereignisse würdigt, sondern auch geschickt das Fundament für einige der bereits angekündigten Marvel-Filme legt, ohne dass man sich jedoch aus der Haupthandlung herausgerissen fühlt. Lob gebührt an dieser Stelle der Marketing-Abteilung von Disney, denn die Trailer verraten diesmal im Vorfeld eigentlich recht wenig, sodass der Film einige gelungene und überraschende Wendungen bietet. Wenn man dem Film etwas vorwerfen kann, dann dass die große Schlacht sich schon sehr nach der aus dem ersten Teil anfühlt. Waren es dort noch gesichtslose Aliens, die von den Avengers mit Leichtigkeit fertiggemacht wurden, sind es hier zahllose generische Roboter, die ebenfalls keine große Hürde für unsere Helden darstellen. Mögliche Kollateralschäden? Von wegen. Der Grund, weshalb es, wie schon im ersten Film und im Gegensatz zu den Endlos-Showdowns von Michael Bays Transformers, nicht langweilig wird, liegt darin, dass die einzelnen Protagonisten keine austauschbaren Blechgiganten sind und jeder auf die eigene Art und Weise seine Fähigkeiten unter Beweis stellt. Ein bisschen Humor hier, ein wenig Herz da, eine Handvoll Tragik dort und jede Menge Action – das Marvel-Rezept funktioniert. Nichtsdestotrotz könnte es beim nächsten Teil nicht schaden, den Avengers etwas anderes als Armaden von leicht besiegbaren, austauschbaren Gegnern vorzusetzen, sodass man sich in jeder Szene nach der Rückkehr des Hauptantagonisten sehnt.
Wenn man dem Film etwas vorwerfen kann, dann dass die große Schlacht sich schon sehr nach der aus dem ersten Teil anfühlt. Waren es dort noch gesichtslose Aliens, die von den Avengers mit Leichtigkeit fertiggemacht wurden, sind es hier zahllose generische Roboter, die ebenfalls keine große Hürde für unsere Helden darstellen. Mögliche Kollateralschäden? Von wegen. Der Grund, weshalb es, wie schon im ersten Film und im Gegensatz zu den Endlos-Showdowns von Michael Bays Transformers, nicht langweilig wird, liegt darin, dass die einzelnen Protagonisten keine austauschbaren Blechgiganten sind und jeder auf die eigene Art und Weise seine Fähigkeiten unter Beweis stellt. Ein bisschen Humor hier, ein wenig Herz da, eine Handvoll Tragik dort und jede Menge Action – das Marvel-Rezept funktioniert. Nichtsdestotrotz könnte es beim nächsten Teil nicht schaden, den Avengers etwas anderes als Armaden von leicht besiegbaren, austauschbaren Gegnern vorzusetzen, sodass man sich in jeder Szene nach der Rückkehr des Hauptantagonisten sehnt.









