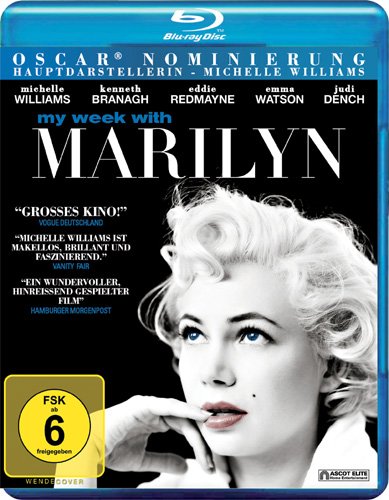"Wer oder was ist Banshee?", höre ich schon die Ersten fragen, die mit dem Namen überhaupt nichts anfangen können. Tatsächlich ist die US-amerikanische Action-Serie noch relativ jung und unbekannt in unseren Breiten und ich stieß auch nur durch ein Poster der ersten Staffel und ein paar positive Rezensionen auf die Serie. Ohne groß weiter zu recherchieren, schwang ich mich also auf die Couch und sah mir die 10 Folgen der ersten Staffel an und ich muss sagen, das Urteil fällt gar nicht so leicht:

Die Pilotfolge beginnt direkt mit unserer vorerst namenlosen Hauptperson (Anthony Starr), einem Häftling, der gerade entlassen wurde und so schnell wie möglich zurück in sein "normales" Leben will. Dabei ist der Einstieg in die Folge sehr gut inszeniert. Starke Bilder und eine stimmige Musik sollen uns direkt in die Thematik hineinschmeißen, und während der Hauptdarsteller mal schnell die Kellnerin der nächstgelegenen Raststätte flachlegt, sich dort ein Auto klaut und direkt gewaltbereit in den Friseursalon seines altbekannten Hackerkumpels Jobe (Hon Lee) marschiert, wird uns klar, was "Banshee" uns liefern will: Überdrehte Action, schlagfertige Dialoge und jede Menge Sex. Das Ganze gipfelt noch in einer Verfolgungsjagd mit ein paar Gangstern, in der dann auch noch ein großer Bus umkippt und über die Straße schlittert und den Zuschauer mit offenem Mund und einem "Bitte was?!?" auf den Lippen zurücklässt. Und dann folgt das geniale Intro.
Der erste richtige Pluspunkt, der die gesamte Staffel durchzieht, ist, dass diese Serie eines der bestern Serienintros geschaffen hat, die mir bekannt sind. Während ein cooler rockiger Song läuft, werden immer wieder Polaroid-Bilder eingeblendet, welche einen Bezug zur Serie und meistens auch spezifisch zur jeweiligen Folge haben. Das Auffallende hier: Das Intro wandelt sich von Folge zu Folge um! So sehen wir anfangs auf den Bildern unter anderem ein auseinandergebautes Maschinengewehr und ein sauberes Messer, und mit jeder Folge wird das Gewehr weiter zusammengebaut und das Messer blutiger. Die Idee eines solch dynamischen Intros ist genial und funktioniert perfekt, sodass sich davon gerne einige Serien eine Scheibe abschneiden können.
 Nach dem Intro beobachten wir unseren Protagonisten dabei, wie er versucht seine alte Liebe aufzuspüren, für die er 15 Jahre hinter Gitter musste, die die ihn all die Zeit am Leben hielt und die ihn doch kein einziges Mal im Gefängnis besucht hat. Doch anstatt sich mit ihr zu versöhnen und zusammen nun endlich ein unbeschwertes Leben zu führen kommt es ganz dicke. Seine damalige Geliebte Anna (Ivana Miličević) besitzt nun den Decknamen Carrie und ist mit dem Anwalt Gordon Hopewell (Rus Blackwell) verheiratet. Mit zwei Kindern wohnt sie in der von außen langweilig scheinenden Kleinstadt Banshee, welche der Serie ihren Namen gibt. Doch anstatt dass unser gebrochener und wütender "Held" abhaut und sich ein eigenes Leben aufbaut, trifft er eine für alle Beteiligten fatale Entscheidung. Bei einem eskalierenden Überfall auf eine Kneipe sieht er den künftigen Sheriff Lucas Hood, der am nächsten Tag in Banshee anfangen sollte, sterben und übernimmt kurzerhand dessen Identität. Nun ist unser Antiheld nicht mehr namenlos, er heißt Lucas Hood.
Nach dem Intro beobachten wir unseren Protagonisten dabei, wie er versucht seine alte Liebe aufzuspüren, für die er 15 Jahre hinter Gitter musste, die die ihn all die Zeit am Leben hielt und die ihn doch kein einziges Mal im Gefängnis besucht hat. Doch anstatt sich mit ihr zu versöhnen und zusammen nun endlich ein unbeschwertes Leben zu führen kommt es ganz dicke. Seine damalige Geliebte Anna (Ivana Miličević) besitzt nun den Decknamen Carrie und ist mit dem Anwalt Gordon Hopewell (Rus Blackwell) verheiratet. Mit zwei Kindern wohnt sie in der von außen langweilig scheinenden Kleinstadt Banshee, welche der Serie ihren Namen gibt. Doch anstatt dass unser gebrochener und wütender "Held" abhaut und sich ein eigenes Leben aufbaut, trifft er eine für alle Beteiligten fatale Entscheidung. Bei einem eskalierenden Überfall auf eine Kneipe sieht er den künftigen Sheriff Lucas Hood, der am nächsten Tag in Banshee anfangen sollte, sterben und übernimmt kurzerhand dessen Identität. Nun ist unser Antiheld nicht mehr namenlos, er heißt Lucas Hood.
Danach vergräbt er mit dem Inhaber der Bar, dem in die Jahre gekommen Boxer und ebenfalls Ex-Knacki Sugar (Frankie Faison), schnell die Leichen und zieht neben der Bar in einen Raum, der mehr an eine Abstellkammer als eine Wohnung erinnert, ein. Nur rechnet Lucas nicht damit, dass er nicht nur mit seiner Vergangenheit in Form vom ukrainischen Gangster-Boss Rabbit (Ben Cross), vor dem er nach einem Diamantenraub mit Anna fliehen wollte, wobei er von der Polizei geschnappt wurde und ins Gefängnis kam, kämpfen muss, sondern auch mit dem zwielichtigen Geschäftsmann Kai Proctor (Ulrich Thomsen), der seine Finger überall in Banshee im Spiel zu haben scheint. Hood muss also nun versuchen ein guter Polizist zu sein, an Anna heranzukommen und gleichzeitig vor Rabbit geheim halten, wo er sich befindet. Doch die "ruhige" Stadt hat noch einiges mehr zu bieten.
 "Banshee" ist von ihrer filmischen Qualität schon mal wirklich nicht schlecht. So sieht man in einigen Folgen wirklich starke Kamerafahrten und Szenen, wie sie vielleicht nicht besonders innovativ oder neu sind, aber stimmig und solide das tun, wozu sie da sind: Sie sehen gut aus. Oft greift die Serie auf Flashbacks zurück, von denen manche wirklich gut sind (z.B: in Folge 6 "Wicks" kommen einige tolle Gefängnis-Flashbacks vor), manche aber auch eher nervig (z.B: Die Vergangenheit des Pärchens Lucas und Anna, die oft eher weniger gut gemacht sind). "Banshee" greift auf einen sehr stimmigen und passenden Soundtrack zurück und generiert gerne auch beklemmend eklige Bilder und Angst einflößend brutale und reale Szenen, bei denen man zum Teil wirklich gerne wegsehen würde. Das ist einerseits positiv, da hier weder Gewalt noch Sex in irgendeiner Hinsicht versucht werden zu zensieren, andererseits schlägt es dann irgendwie doch über die Stränge, wenn man das Gefühl bekommt, in jeder Folge muss mindestens eine explizite Sexszene sein, oder eine gewisse Menge an Schlägen ausgeteilt werden, damit die Macher der Serie zufrieden gestellt sind. Dadurch wirkt das dann leider an einigen Stellen doch eher gestellt, als wirklich authentisch und gut. So nervt zum Beispiel Proctors anscheinend dauernackte Nichte Rebecca manchmal gewaltig oder auch Hood, der mit jedem zweiten weiblichen Charakter ins Bett springt.
"Banshee" ist von ihrer filmischen Qualität schon mal wirklich nicht schlecht. So sieht man in einigen Folgen wirklich starke Kamerafahrten und Szenen, wie sie vielleicht nicht besonders innovativ oder neu sind, aber stimmig und solide das tun, wozu sie da sind: Sie sehen gut aus. Oft greift die Serie auf Flashbacks zurück, von denen manche wirklich gut sind (z.B: in Folge 6 "Wicks" kommen einige tolle Gefängnis-Flashbacks vor), manche aber auch eher nervig (z.B: Die Vergangenheit des Pärchens Lucas und Anna, die oft eher weniger gut gemacht sind). "Banshee" greift auf einen sehr stimmigen und passenden Soundtrack zurück und generiert gerne auch beklemmend eklige Bilder und Angst einflößend brutale und reale Szenen, bei denen man zum Teil wirklich gerne wegsehen würde. Das ist einerseits positiv, da hier weder Gewalt noch Sex in irgendeiner Hinsicht versucht werden zu zensieren, andererseits schlägt es dann irgendwie doch über die Stränge, wenn man das Gefühl bekommt, in jeder Folge muss mindestens eine explizite Sexszene sein, oder eine gewisse Menge an Schlägen ausgeteilt werden, damit die Macher der Serie zufrieden gestellt sind. Dadurch wirkt das dann leider an einigen Stellen doch eher gestellt, als wirklich authentisch und gut. So nervt zum Beispiel Proctors anscheinend dauernackte Nichte Rebecca manchmal gewaltig oder auch Hood, der mit jedem zweiten weiblichen Charakter ins Bett springt.
Die Handlung ist ziemlich verstrickt und gestaltet sich teilweise auch als äußerst interessant, allerdings mit starken Differenzen zwischen den unterschiedlichen Handlungssträngen. So schafft es die Geschichte um Rabbits ukrainische Mafiosi nie wirklich zu packen, mehr wird sie einem Klischee nach dem anderen gerecht, wodurch Hoods Vergangenheit leider immer mehr ins Uninteressante abgleitet und Ben Cross als Rabbit oft wenig nachvollziehbar erscheint, geschweige denn einen soliden und durchgehend verständlichen Charakter abbildet (am meisten stört hier, wie uns ständig verklickert werden soll, dass Rabbit Schach spielt). Das genaue Gegenteil von Langeweile erfährt man durch Kai Proctors Storyline, dessen zwielichtigen Geschäfte und Intrigen sich als überraschend interessant gestalten und seine Konflikte mit der Stadt, dem ortsansässigen Indianerstamm oder später auch mit Hood gehören zu dem besten was "Banshee" zu bieten hat. Ulrich Thomsen hat die besten Szenen der Serie und auch die besten Dialoge, wodurch es mir nicht schwer fällt zu sagen, dass ich gerne mehr von ihm sehen würde, denn er füllt die Rolle wirklich fabelhaft aus (Ich sage nur "Ein Prosit der Gemütlichkeit!").
 Auch der Australier Anthony Starr weiß in seiner Rolle als penetrant ignoranter Schläger-Bulle aufzugehen. Von ein paar zu starren Dialogen abgesehen bringt er vor allem die ständige Verzweiflung des Charakters sehr gut ins Bild und hat einen gewissen schlagfertigen Witz, welcher in vielen Szenen gut funktioniert. Ebenfalls viel Spaß macht Hon Lee als metrosexueller Asiate und Hacker-Genie Jobe, der sehr unterhaltsam anzusehen ist (vor allem wenn er beleidigend wird) und eine super Hass-Liebe zu Barbesitzer Sugar ausbildet. Eher weniger gut gefallen mir Ben Cross als Rabbit und Ivana Miličević als Anna, doch das liegt hauptsächlich an den teils einfach nicht gut geschriebenen Rollen und weniger an den beiden Schauspielern, die hier versuchen noch das Beste herauszuholen.
Auch der Australier Anthony Starr weiß in seiner Rolle als penetrant ignoranter Schläger-Bulle aufzugehen. Von ein paar zu starren Dialogen abgesehen bringt er vor allem die ständige Verzweiflung des Charakters sehr gut ins Bild und hat einen gewissen schlagfertigen Witz, welcher in vielen Szenen gut funktioniert. Ebenfalls viel Spaß macht Hon Lee als metrosexueller Asiate und Hacker-Genie Jobe, der sehr unterhaltsam anzusehen ist (vor allem wenn er beleidigend wird) und eine super Hass-Liebe zu Barbesitzer Sugar ausbildet. Eher weniger gut gefallen mir Ben Cross als Rabbit und Ivana Miličević als Anna, doch das liegt hauptsächlich an den teils einfach nicht gut geschriebenen Rollen und weniger an den beiden Schauspielern, die hier versuchen noch das Beste herauszuholen.
Nachdem die ersten 3-4 Folgen alle relativ gut sind, gibt es einen Hänger in der Mitte der Serie, angeführt von einer ziemlich dürftigen Folge, in der eine Bikergang Banshee unsicher macht, doch bis zum Finale fängt sie sich wieder und liefert zwei durchaus gute letzte Folgen ab. Das Staffelfinale lässt so einige Überraschungen hochgehen, bleibt aber leider nicht so konsequent wie gewünscht. Trotzdem stellt es die beste Folge der Staffel dar, hat einige tolle Kampfchoreografien und Schusswechsel und gibt einen interessanten Ausblick auf die Zukunft der Kleinstadt und all ihre schmutzigen Geheimnisse die ans Tageslicht kommen.
Fazit
Wer mit "Banshee" eine Serie erwartet, die mit hochqualitativem Storytelling und ausgefeilten Dialogen nur so gespickt ist… naja, der kann gleich wieder abschalten. Die Show hat einen ziemlich interessanten Plot, der aber durch all die Superlative und die übertriebene Action oft mehr in den Hintergrund rückt. Man sollte also wenn man mit dieser Serie Spaß haben will nicht alles zu ernst nehmen. "Banshee" ist eine ziemlich spezielle Serie und das will sie auch sein. So ist sie sicher etwa für Fans von Action und jeder Menge Frauen und Gewalt, dabei aber nie wirklich niveaulos oder banal, andererseits leider auch nicht bahnbrechend bedeutungsvoll. Mithalten mit den ganz großen Serien kann sie zweifelsohne nicht, aber das versucht sie ja auch gar nicht. Die erste Staffel ist unterhaltsam und vor allem Ulrich Thomsen als Bösewicht Proctor immer wieder eine Augenweide. Deswegen hoffe ich darauf, dass es in Zukunft mehr von ihm und weniger von Rabbit zu sehen gibt und sehe letzten Endes in der ersten Staffel von "Banshee" durchaus Potenzial für die Serie, aber eben auch noch einiges an Luft nach oben.



 Batman, äh natürlich „Birdman“ Michael Keaton ist die Speerspitze dieses spielfreudigen Kreuzzuges durch die unwirtlichen Charakterwüsten von Hollywood-Sternchen, Möchtegern-Künstlern und scheinbar sonstigen Taugenichtsen, die sich alle gegenseitig das Leben schwer machen. Als Vorwand dient der künstlerische Anspruch, um die notgeile Geltungsbedürftigkeit der einen und irgendwie unverhohlene Profitgeilheit der anderen zu kaschieren. Keatons Rolle verfügt über übersinnliche Kräfte, kann er mittels Gedankenkraft beispielsweise einen Scheinwerfer auf einen untalentierten Schauspielerkollegen fallen lassen, um diesen durch den exzentrischen Draufgänger Edward Norton zu ersetzen (der obendrein ein dicker Name am Broadway ist – Ticketverkauf!). Abseits davon schwebt er als Meditationsform in seiner Umkleide herum und lauscht der brummenden schizophrenen Badass-Stimme von „Birdman“ in seinem Kopf. Hier hören er und der Zuschauer den Off-Kommentar eines übergroßen Egos bei der Reflektion des Geschehens zu. „Birdman“ ist für Riggan Thomson hilfreicher, motivationaler Anker, aber auch leidvoller Ballast zugleich. Ignoranz und Beharrlichkeit können Tugenden sein, um ein Ziel zu erreichen. Mit welcher Erkenntnisresistenz man nun zu Tate schreitet, ist jedoch essentiell. Wie bereits in anderen Werken („Biutiful“), lässt Alejandro González Iñárritu das Fantastische mit der realen Welt im Einklang verschmelzen. Neben Keatons Mut zur authentischen und natürlichen Normalo-„Hässlichkeit“ (Perücke über das ohnehin dünne Haar), überzeugt sein völlig selbstsicheres, selbstironisches Auftreten. Ein durch und durch ambivalenter Charakter, der eine Beachtung seitens der Oscar-Wähler garantieren sollte. Als Punkt auf dem „i“ erweist sich Riggans Flugfähigkeit als freche Metapher für den Höhenflug blasierter, aufgeblasener Promis.
Batman, äh natürlich „Birdman“ Michael Keaton ist die Speerspitze dieses spielfreudigen Kreuzzuges durch die unwirtlichen Charakterwüsten von Hollywood-Sternchen, Möchtegern-Künstlern und scheinbar sonstigen Taugenichtsen, die sich alle gegenseitig das Leben schwer machen. Als Vorwand dient der künstlerische Anspruch, um die notgeile Geltungsbedürftigkeit der einen und irgendwie unverhohlene Profitgeilheit der anderen zu kaschieren. Keatons Rolle verfügt über übersinnliche Kräfte, kann er mittels Gedankenkraft beispielsweise einen Scheinwerfer auf einen untalentierten Schauspielerkollegen fallen lassen, um diesen durch den exzentrischen Draufgänger Edward Norton zu ersetzen (der obendrein ein dicker Name am Broadway ist – Ticketverkauf!). Abseits davon schwebt er als Meditationsform in seiner Umkleide herum und lauscht der brummenden schizophrenen Badass-Stimme von „Birdman“ in seinem Kopf. Hier hören er und der Zuschauer den Off-Kommentar eines übergroßen Egos bei der Reflektion des Geschehens zu. „Birdman“ ist für Riggan Thomson hilfreicher, motivationaler Anker, aber auch leidvoller Ballast zugleich. Ignoranz und Beharrlichkeit können Tugenden sein, um ein Ziel zu erreichen. Mit welcher Erkenntnisresistenz man nun zu Tate schreitet, ist jedoch essentiell. Wie bereits in anderen Werken („Biutiful“), lässt Alejandro González Iñárritu das Fantastische mit der realen Welt im Einklang verschmelzen. Neben Keatons Mut zur authentischen und natürlichen Normalo-„Hässlichkeit“ (Perücke über das ohnehin dünne Haar), überzeugt sein völlig selbstsicheres, selbstironisches Auftreten. Ein durch und durch ambivalenter Charakter, der eine Beachtung seitens der Oscar-Wähler garantieren sollte. Als Punkt auf dem „i“ erweist sich Riggans Flugfähigkeit als freche Metapher für den Höhenflug blasierter, aufgeblasener Promis. So viel der Vorschusslorbeeren für Michael Keaton, begeistert der restliche Cast keineswegs weniger. Sogar die Nebenrollen sind hitverdächtig. Naomi Watts tapst als alternde, auf den Erfolg wartende Broadway-Sirene Lesley durch die Theaterschluchten. Während Andrea Riseborough als Laura ihr verschrobenes Techtelmechtel mit Riggan bejammert, grämt sich Lesley wegen ihrer stagnierenden Karriere. Beide trösten sich mit abgedroschenen Floskeln trauernder Diven des Showbiz à la „Herzchen, du bist klasse, denk‘ nicht an die anderen da draußen“, was schließlich in einer der zahlreichen bösartigen satirischen Gipfel kulminiert, wenn sie sich am Ende belächeln und einsehen, wie fade, hohl, verlogen und hinterfotzig dieses Gerede an sich ist. Emma Stone brilliert in der Rolle von Riggans Assistentin und Tochter Sam mit emotionaler Labilität (Drogensucht, schwieriger Künstler-Daddy) und teilt sich mit Edward Norton einige sehr verruchte Augenblicke. Der dandyhafte Exzentriker Mike (Edward Norton) rauscht phänomenal mit seiner nervigen Künstleraffektiertheit und dem Gespür, ständig zum falschen Zeitpunkt Frauen anzubaggern (Ex-Freundin Lesley, Riggans Tochter Sam), durch die Theaterproduktion. Um nicht noch mehr vorwegzunehmen, soll dies zu den schauspielerischen Paradeleistungen genug sein. Iñárritu gelingt es, von Manager Jake bis hin zur Kritikerkönigin Tabitha (Lindsay Duncan) oder gar Riggan selbst quasi als Archetypen für seinen persiflierenden, kritikfreudigen Spießrutenlauf durch das Showgeschäft anzulegen, sodass jede Seite von dem Manager-„Freund“ bis hin zur Missgunst der Kritikergilde oder Schauspieler, die den letzten verzweifelten Griff nach dem verbleibenden Strohhalm ihrer Karriere wagen, den Spiegel vorgehalten bekommen. Dies gelingt dem Schreiberling (nicht nur Iñárritu) und zugleich Regisseur unaufdringlich und teilweise auch subtil, dass Manches einem erst hinterher so richtig einleuchtet, mit Nachbrenneffekt.
So viel der Vorschusslorbeeren für Michael Keaton, begeistert der restliche Cast keineswegs weniger. Sogar die Nebenrollen sind hitverdächtig. Naomi Watts tapst als alternde, auf den Erfolg wartende Broadway-Sirene Lesley durch die Theaterschluchten. Während Andrea Riseborough als Laura ihr verschrobenes Techtelmechtel mit Riggan bejammert, grämt sich Lesley wegen ihrer stagnierenden Karriere. Beide trösten sich mit abgedroschenen Floskeln trauernder Diven des Showbiz à la „Herzchen, du bist klasse, denk‘ nicht an die anderen da draußen“, was schließlich in einer der zahlreichen bösartigen satirischen Gipfel kulminiert, wenn sie sich am Ende belächeln und einsehen, wie fade, hohl, verlogen und hinterfotzig dieses Gerede an sich ist. Emma Stone brilliert in der Rolle von Riggans Assistentin und Tochter Sam mit emotionaler Labilität (Drogensucht, schwieriger Künstler-Daddy) und teilt sich mit Edward Norton einige sehr verruchte Augenblicke. Der dandyhafte Exzentriker Mike (Edward Norton) rauscht phänomenal mit seiner nervigen Künstleraffektiertheit und dem Gespür, ständig zum falschen Zeitpunkt Frauen anzubaggern (Ex-Freundin Lesley, Riggans Tochter Sam), durch die Theaterproduktion. Um nicht noch mehr vorwegzunehmen, soll dies zu den schauspielerischen Paradeleistungen genug sein. Iñárritu gelingt es, von Manager Jake bis hin zur Kritikerkönigin Tabitha (Lindsay Duncan) oder gar Riggan selbst quasi als Archetypen für seinen persiflierenden, kritikfreudigen Spießrutenlauf durch das Showgeschäft anzulegen, sodass jede Seite von dem Manager-„Freund“ bis hin zur Missgunst der Kritikergilde oder Schauspieler, die den letzten verzweifelten Griff nach dem verbleibenden Strohhalm ihrer Karriere wagen, den Spiegel vorgehalten bekommen. Dies gelingt dem Schreiberling (nicht nur Iñárritu) und zugleich Regisseur unaufdringlich und teilweise auch subtil, dass Manches einem erst hinterher so richtig einleuchtet, mit Nachbrenneffekt. Das Setting bleibt zum größten Teil indoor in einem Broadwaytheater. So bekommt man dann auch ganz nonchalant die verwinkelten labyrinthenhaften Ecken eines solchen Theaters vorgeführt. Die ganze Arbeit an so einem Stück wird dadurch greifbar gemacht. Das ganz große Lob heimst die schwebend, gleitende, weitestgehend schnittfreie Kameraführung ein. Hitchcocks „Cocktail für eine Leiche“ kam bereits (fast) ohne Schnitte aus und eingesetzt als Stilmittel in moderneren Filmen sorgte zum Beispiel die lange Kamerafahrt zu Beginn in „Gravity“ für eine unglaubliche Tiefe und Schwerelosigkeit, oder die Gefängnishof-Kampf-Szene in „The Raid 2“ gewann an epischer Dynamik. Alejandro González Iñárritu lässt seine Kamera bei Zeiten fast unentschlossen hinter irgendeinem der Figuren seines Films her stiefeln, als sei der Zuschauer ein unbeteiligter, unsichtbarer Dritter im Raum. Meist befindet man sich im Verfolgermodus und bleibt dann auf dem Weg wieder bei dem nächsten Aufeinandertreffen der Figuren im Theater hängen. Untermalt wird dies von Marsch-artigen Drumsets, die niemals lediglich als Tusch herhalten, sondern akzentuiert die wabernde, emsige, hektische Interaktion in dem Theater wiederhallen lassen.
Das Setting bleibt zum größten Teil indoor in einem Broadwaytheater. So bekommt man dann auch ganz nonchalant die verwinkelten labyrinthenhaften Ecken eines solchen Theaters vorgeführt. Die ganze Arbeit an so einem Stück wird dadurch greifbar gemacht. Das ganz große Lob heimst die schwebend, gleitende, weitestgehend schnittfreie Kameraführung ein. Hitchcocks „Cocktail für eine Leiche“ kam bereits (fast) ohne Schnitte aus und eingesetzt als Stilmittel in moderneren Filmen sorgte zum Beispiel die lange Kamerafahrt zu Beginn in „Gravity“ für eine unglaubliche Tiefe und Schwerelosigkeit, oder die Gefängnishof-Kampf-Szene in „The Raid 2“ gewann an epischer Dynamik. Alejandro González Iñárritu lässt seine Kamera bei Zeiten fast unentschlossen hinter irgendeinem der Figuren seines Films her stiefeln, als sei der Zuschauer ein unbeteiligter, unsichtbarer Dritter im Raum. Meist befindet man sich im Verfolgermodus und bleibt dann auf dem Weg wieder bei dem nächsten Aufeinandertreffen der Figuren im Theater hängen. Untermalt wird dies von Marsch-artigen Drumsets, die niemals lediglich als Tusch herhalten, sondern akzentuiert die wabernde, emsige, hektische Interaktion in dem Theater wiederhallen lassen.