Quelle: Internationale Filmfestspiele Berlin
Zum 64. Mal wurden gestern im Rahmen einer festlichen Gala die Preise der Internationalen Filmfestspiele Berlin verliehen. Bestimmt wurden die Sieger in den Hauptkategorien von einer Jury, die dieses Jahr vom Erfolgsproduzenten und Drehbuchautor James Shamus (Brokeback Mountain, Tiger & Dragon) geleitet wurde. Neben ihm saßen in der Jury u. a. die Mumblecore-Queen Greta Gerwig (Frances Ha), die James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli und der zweifache Oscargewinner Christoph Waltz (Django Unchained). Der große Favorit der Jury war dieses Jahr der chinesische Thriller Black Coal, Thin Ice (unsere Filmkritik), der gleich mit zwei Preisen ausgezeichnet wurde. Neben dem Goldenen Bären als "Bester Film" der Berlinale 2014, wurde der Streifen auch mit einem Silbernen Bären für "Besten Darsteller" (Fan Liao) ausgezeichnet. Als Gewinner des Goldenen Bären gestellt sich Black Coal, Thin Ice damit zu Steifen wie Gegen die Wand, Nader und Simin – Eine Trennung, Magnolia und Der schmale Grat. Interessant ist natürlich, ob der Film auch weltweit Bekanntheit und Erfolg erreichen wird wie diese vier oder eher schnell "vergessen" wird wie die Berlinale-Gewinner Der Lockvogel, In this World und U-Carmen (natürlich nur meine persönliche Einschätzung).
Bevor ich auf die weiteren Gewinner eingehe, hier einen kurze Erklärung zu den zahloreichen und manchmal verwirrenden Preisen, die bei der Berlinale aktuell verliehen werden. Neben dem allseits bekannten Goldenen Bären für den "Besten Film" werden Silberne Bären in mehreren Kategorien verliehen. Neben "Bester Regie", "Bestem Darsteller", "Bester Darstellerin", "Bestem Drehbuch", "Herausragender künstlerischer Leistung (aus den Kategorien Kamera, Schnitt, Musik, Kostüm oder Set-Design)" gehört dazu auch der "Große Preis der Jury". Mit der letzten Auszeichnung ist eigentlich der zweitplatzierte Film des Wettbewerbs gemeint. Wie auch der gleichnamige Preis dem Filmfestival von Cannes, ist der Große Preis der Jury die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals. Außerdem verleiht die Jury seit 1987 den Alfred-Bauer-Preis (benannt nach dem Berlinale-Gründer), ebenfalls in Form eines Silbernen Bären. Dieser geht an einen Wettbewerbsfilm, "der der Filmkunst neue Perspektiven eröffnet". Beispiele für bisherige Gewinner dieses Preises sind Hero, Maria voll der Gnade und Wer wenn nicht wir.
Unabhängig von der Jury wird bei der Belinale eine große Anzahl an weiteren Preisen verliehen. Darunter befindet sich zum Beispiel der Gläserne Bär, der von einer Kinderjury/Jugendjury an den besten Spielfilm und Kurzfilm der Sektion "Generation" verliehen wird. Ebenfalls ein wichtiger Preis ist der FIPRESCI-Preis, der von dem Filmkritikerverband FIPRESCI ("Fédération Internationale de la Presse Cinématographique") bei diversen Filmfestivals verliehen wird (darunter in Cannes, Venedig und Berlin). Hier werden jeweils ein Film aus den Sektionen "Wettbewerb", "Forum" und "Panorama" ausgezeichnet. Eine komplette Übersicht über alle Preise und Gewinner findet Ihr hier.
Neben Black Coal, Thin Ice wurden auch zwei Favoriten des Festivals ausgezeichnet – Richard Linklaters Boyhood, der den Preis für seine Regie erhielt, womit Linklaters ambitionierter, 12 Jahre andauernder Dreh belohnt wurde und Wes Andersons Grand Budapest Hotel, der mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde. Weitere Gewinner aus den wichtigsten Kategorien könnt Ihr unten sehen:
Goldener Bär für den Besten Film
Silberner Bär als Großer Preis der Jury
Silberner Bär für die Beste Regie
Richard Linklater (Boyhood)
Silberner Bär für die Beste Darstellerin
Haru Kuroki (The Little House)
Silberner Bär für den Besten Darsteller
Fan Liao (Black Coal, Thin Ice)
Silberner Bär für das Beste Drehbuch
Anna und Dietrich Brüggemann (Kreuzweg)
Silberner Bär Alfred-Bauer-Preis
Alain Resnais (Life of Riley)
Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung
Zeng Jian für die Kamera in Blind Massage
Generation Kplus Kinderjury:
Gläserner Bär für den besten Spielfilm
Killa
Lobende Erwähnung: Joy of Man’s Desiring
Generation 14plus Jugendjury:
Gläserner Bär für den besten Spielfilm
52 Tuesdays
Lobende Erwähnung: ärtico
FIPRESCI-Preise
Wettbewerb: Life of Riley (von Alain Resnais)
Panorama: The Way He Looks (von Daniel Ribeiro)
Forum: Forma (von Ayumi Sakamoto)


 „Glaubst du irgendwer gewinnt je im Leben?“, fragt der heruntergekommene Ex-Detective Zhang. Diao Yi’nans makaberer Noir verdient es jedenfalls allein schon für seine zwielichtigen Bilder. Er vereint zwei durchgängige Topoi des diesjährigen Berlinale-Wettbewerbs. Das eine sind subtile Zitate der Schwarzen Serie wie in
„Glaubst du irgendwer gewinnt je im Leben?“, fragt der heruntergekommene Ex-Detective Zhang. Diao Yi’nans makaberer Noir verdient es jedenfalls allein schon für seine zwielichtigen Bilder. Er vereint zwei durchgängige Topoi des diesjährigen Berlinale-Wettbewerbs. Das eine sind subtile Zitate der Schwarzen Serie wie in  Die deprimierende Stimmung der bitterbösen Hardboiled-Story von Besessenheit und Begierde untergräbt der rabenschwarze Humor des Regisseurs und Autoren. Ebenso ingeniös erhellen die visuellen Nachtstücke von Kameramann Dong Jinsong die Tristesse der Fabrikstadt. Tag und Nacht schuften die Arbeiter am Fließband, auf dem sie schließlich selbst mausetot landen. Kein Grund vom Dienstplan abzuweichen. Das Pensum muss geschafft werden und jeder seinen Beitrag dazu leisten. Die staatliche Maschinerie verleibt sich ihre Bürger ein und sorgt indirekt dafür, dass sie ebenso handeln, wenn sie unwissentlich den Kollegen nach Feierabend im Nachtlokal verzehren. Die bissige Systemkritik macht aus Beiläufigkeiten hinterhältig delikate Indizien. So etwa steht Zhizhen in einem Imbiss auf und geht, kaum dass der Kellner das dampfende Essen vor ihr abstellt. Was da wohl in den Bao-Klößchen war…? Die scheue Femme Fatale hat noch die meisten Skrupel unter den kuriosen bis krankhaften Figuren, die einander in dem verwickelten Geflecht aus Zudringlichkeit und Abhängigkeit wieder begegnen: um einen Paartanz aufs Parkett zu legen oder mit einem Schlittschuh abgestochen zu werden. Wer weiß?
Die deprimierende Stimmung der bitterbösen Hardboiled-Story von Besessenheit und Begierde untergräbt der rabenschwarze Humor des Regisseurs und Autoren. Ebenso ingeniös erhellen die visuellen Nachtstücke von Kameramann Dong Jinsong die Tristesse der Fabrikstadt. Tag und Nacht schuften die Arbeiter am Fließband, auf dem sie schließlich selbst mausetot landen. Kein Grund vom Dienstplan abzuweichen. Das Pensum muss geschafft werden und jeder seinen Beitrag dazu leisten. Die staatliche Maschinerie verleibt sich ihre Bürger ein und sorgt indirekt dafür, dass sie ebenso handeln, wenn sie unwissentlich den Kollegen nach Feierabend im Nachtlokal verzehren. Die bissige Systemkritik macht aus Beiläufigkeiten hinterhältig delikate Indizien. So etwa steht Zhizhen in einem Imbiss auf und geht, kaum dass der Kellner das dampfende Essen vor ihr abstellt. Was da wohl in den Bao-Klößchen war…? Die scheue Femme Fatale hat noch die meisten Skrupel unter den kuriosen bis krankhaften Figuren, die einander in dem verwickelten Geflecht aus Zudringlichkeit und Abhängigkeit wieder begegnen: um einen Paartanz aufs Parkett zu legen oder mit einem Schlittschuh abgestochen zu werden. Wer weiß? Jedenfalls nicht Detective Zhang (Fan Liao), der zu Filmbeginn 1999 in der Mordserie ermittelt und als einziger eine aberwitzige Schießerei überlebt. Fünf Jahre später, als erneut ein Killer nach gleichem Muster Körperteile in der Landschaft verteilt, jobbt Zhang inzwischen als Wachmann und ist ansonsten Alkoholiker. Außerdem ist er das Biest – weder das erste noch das einzige, das Zhizhen umschleicht. Der Täter, der im Schatten taktiert, und der abgerissene Ex-Ermittler, der seine Nachforschungen auf eigene Faust wieder aufnimmt, haben viele Gemeinsamkeiten. Zu viele, als dass in dem enigmatischen Kuriositätenkabinett jemals ein Gefühl der Sicherheit aufkäme. Cop und Killer leitet eine morbide Obsession mit der verschlossenen Wäschereiarbeiterin. Zhang folgt Zhizhen an den Arbeitsplatz, durch Unterführungen, in denen ein anderer heimlicher Verfolger lauern mag, und zugefrorene Straßen. Diao genießt es, Protagonisten und Publikum an immer bizarrere Orte zu führen, die Neon-Licht und blinkende Leuchtschrift in phantasmagorische Karnevalsbeleuchtung tauchen. So kulminiert der Plot in einer Riesenradgondel, wo man fast erwartet, dass die Figuren anfingen, von Kuckucksuhren zu sprechen.
Jedenfalls nicht Detective Zhang (Fan Liao), der zu Filmbeginn 1999 in der Mordserie ermittelt und als einziger eine aberwitzige Schießerei überlebt. Fünf Jahre später, als erneut ein Killer nach gleichem Muster Körperteile in der Landschaft verteilt, jobbt Zhang inzwischen als Wachmann und ist ansonsten Alkoholiker. Außerdem ist er das Biest – weder das erste noch das einzige, das Zhizhen umschleicht. Der Täter, der im Schatten taktiert, und der abgerissene Ex-Ermittler, der seine Nachforschungen auf eigene Faust wieder aufnimmt, haben viele Gemeinsamkeiten. Zu viele, als dass in dem enigmatischen Kuriositätenkabinett jemals ein Gefühl der Sicherheit aufkäme. Cop und Killer leitet eine morbide Obsession mit der verschlossenen Wäschereiarbeiterin. Zhang folgt Zhizhen an den Arbeitsplatz, durch Unterführungen, in denen ein anderer heimlicher Verfolger lauern mag, und zugefrorene Straßen. Diao genießt es, Protagonisten und Publikum an immer bizarrere Orte zu führen, die Neon-Licht und blinkende Leuchtschrift in phantasmagorische Karnevalsbeleuchtung tauchen. So kulminiert der Plot in einer Riesenradgondel, wo man fast erwartet, dass die Figuren anfingen, von Kuckucksuhren zu sprechen.
 Die Angstmiene im Gesicht des jungen Pola (Jonathan Da Rosa), mit der die unterentwickelte Verhaltensstudie schließt, ist nur aufgesetzt. Der etwa gleichaltrige Camilo (Francisco Lumerman) fordert in einer Art Sitzung Pola zum Grimassieren auf und stellt anderen Figuren einschüchternde Fragen. Im Hintergrund dokumentiert alles eine Kamera, was die Konstellation gleichnishaft der des Filmemachers zu seinen Darstellern gegenüberstellt. Furcht ist das übergreifende Thema von Naishtats kantigem Konstrukt. Handlung und Charakterentwicklung werden darin systematisch ausgespart. Stattdessen konzentriert sich der argentinische Regisseur und Drehbuchautor auf das Einfangen verschiedener Abstufungen der titelgebenden Emotion. Sie beginnt milde mit der Irritation, die ein über den Vororten von Buenos Aires kreisender Polizeihubschrauber auslöst. Per Lautsprecher versuchen die Beamten eine Sicherheitswarnung durchzugeben, aber technisches Versagen hindert sie daran. Von der Nachricht dringt gerade genug durch, um eine rätselhafte Gefahrenlage zu umreißen. Am Boden beobachten die Anwohner den über ihren Grundstücken kreisenden Hubschrauber ohne verstehen zu können, was sie bedrohen mag und wie sie dem begegnen könnten.
Die Angstmiene im Gesicht des jungen Pola (Jonathan Da Rosa), mit der die unterentwickelte Verhaltensstudie schließt, ist nur aufgesetzt. Der etwa gleichaltrige Camilo (Francisco Lumerman) fordert in einer Art Sitzung Pola zum Grimassieren auf und stellt anderen Figuren einschüchternde Fragen. Im Hintergrund dokumentiert alles eine Kamera, was die Konstellation gleichnishaft der des Filmemachers zu seinen Darstellern gegenüberstellt. Furcht ist das übergreifende Thema von Naishtats kantigem Konstrukt. Handlung und Charakterentwicklung werden darin systematisch ausgespart. Stattdessen konzentriert sich der argentinische Regisseur und Drehbuchautor auf das Einfangen verschiedener Abstufungen der titelgebenden Emotion. Sie beginnt milde mit der Irritation, die ein über den Vororten von Buenos Aires kreisender Polizeihubschrauber auslöst. Per Lautsprecher versuchen die Beamten eine Sicherheitswarnung durchzugeben, aber technisches Versagen hindert sie daran. Von der Nachricht dringt gerade genug durch, um eine rätselhafte Gefahrenlage zu umreißen. Am Boden beobachten die Anwohner den über ihren Grundstücken kreisenden Hubschrauber ohne verstehen zu können, was sie bedrohen mag und wie sie dem begegnen könnten. Noch befremdlicher sind die psychosomatischen Symptome einer ubiquitären Destabilisierung. Eines Tages bricht die Haushälterin einer wohlhabenden Familie zusammen, als ersticke sie die unentrinnbare Atmosphäre der Furcht. In einem Fast-Food-Restaurant erleidet ein Kunde (Daniel Leguizamon) plötzlich einen bizarren Anfall. Mitten auf der Straße attackiert ein nackter Passant ein vorbeifahrendes Auto. Jungen aus der privilegierten Nachbarschaft werfen Knallkörper in den Pool und auf die um die Villen streunenden Hunde. Weder Drahtzäune um die Grundstücke, noch bezahltes Wachpersonal vermögen die bissigen Tiere abzuhalten. Ihre Silhouetten in der Dunkelheit und ihr Kläffen strapazieren zusätzlich die Nerven, die bei den Anwohnern so blank liegen, dass jedes Gespräch in Streit ausarten kann. History of Fear zeigt Angst als ein Perpetuum mobile, das langsam außer Kontrolle gerät. Ist die Ursache oder Art einer Bedrohung nicht festzulegen, kann umgekehrt jeder gefährlich sein. Misstrauisch beäugen die Menschen einander, kichern gezwungen oder schweigen verbissen. Die emotionale Abkapselung spiegelt ihre positionelle Abschottung von der Restgesellschaft und kreiert zugleich ein weiteres Verdachtsmoment.
Noch befremdlicher sind die psychosomatischen Symptome einer ubiquitären Destabilisierung. Eines Tages bricht die Haushälterin einer wohlhabenden Familie zusammen, als ersticke sie die unentrinnbare Atmosphäre der Furcht. In einem Fast-Food-Restaurant erleidet ein Kunde (Daniel Leguizamon) plötzlich einen bizarren Anfall. Mitten auf der Straße attackiert ein nackter Passant ein vorbeifahrendes Auto. Jungen aus der privilegierten Nachbarschaft werfen Knallkörper in den Pool und auf die um die Villen streunenden Hunde. Weder Drahtzäune um die Grundstücke, noch bezahltes Wachpersonal vermögen die bissigen Tiere abzuhalten. Ihre Silhouetten in der Dunkelheit und ihr Kläffen strapazieren zusätzlich die Nerven, die bei den Anwohnern so blank liegen, dass jedes Gespräch in Streit ausarten kann. History of Fear zeigt Angst als ein Perpetuum mobile, das langsam außer Kontrolle gerät. Ist die Ursache oder Art einer Bedrohung nicht festzulegen, kann umgekehrt jeder gefährlich sein. Misstrauisch beäugen die Menschen einander, kichern gezwungen oder schweigen verbissen. Die emotionale Abkapselung spiegelt ihre positionelle Abschottung von der Restgesellschaft und kreiert zugleich ein weiteres Verdachtsmoment.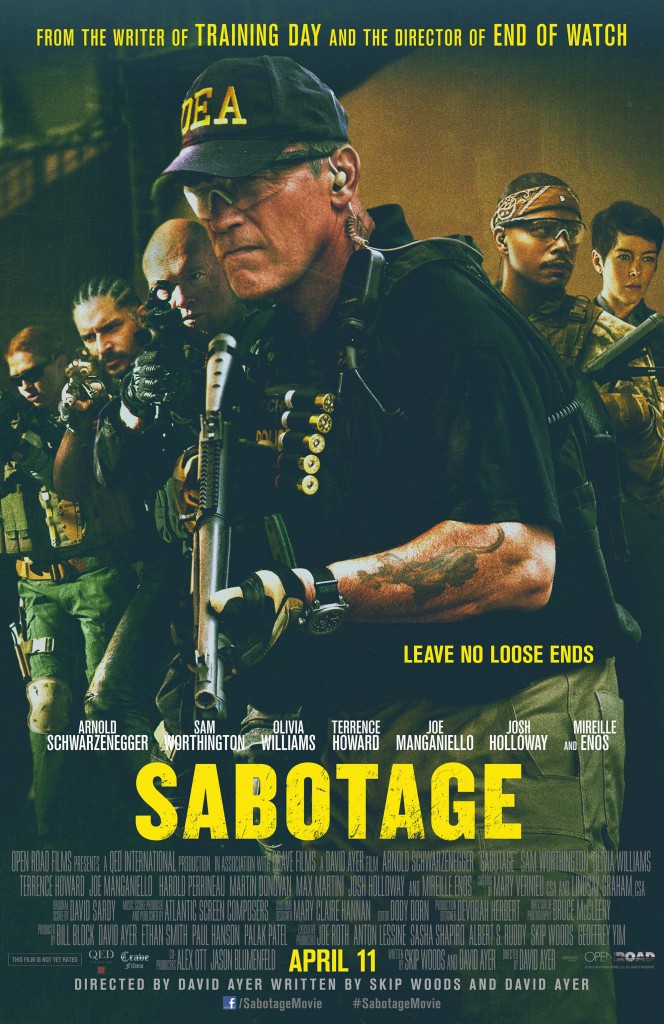


 Er klammert sich weiterhin an seine Illusionen von einer Karriere als Musiker; eine künstlerische Ambition, die sich Jahre später in den photografischen Gehversuchen seines Sohnes widerspiegelt. Die Parallelen, die der episodische Plot zwischen Einst und Jetzt zieht, sind so offenkundig, dass es ihre Signifikanz eher untergräbt als zu unterstreichen. So banal ist die Entwicklung der Geschichte und ihrer Figuren, dass alles vermeintlich psychologisch Angebahnte ebenso gut reiner Zufall sein könnte. Die Belanglosigkeit des filmischen Familienalbums voll sentimentaler, intimer und, da dies in keiner dramatisierten Dia-Show fehlen darf, melancholischer Aufnahmen findet ihr adäquates Pendant in den turnusmäßig eingeworfenen populärkulturellen Fanalen. Wichtiger als ihre Funktion als chronologische Marksteine ist die als Köder für das Publikum, sich zu identifizieren: mit den Figuren, vor allem aber mit der Zeit, die der wahre Hauptakteur ist. Der erste Band „Harry Potter“, den die Mutter vorliest, führt dazu, dass alle schließlich um Mitternacht Schlange stehen, um einen der Folgebände zu erwerben. Weil es in der Welt da draußen noch ernstere Auseinandersetzungen gab als die des Zauberschülers, fallen bisweilen ein paar Worte über den Irak-Krieg. Ansonsten laufen Coldplay und irgendwann sogar Gotyes „Somebody that I used to know“.
Er klammert sich weiterhin an seine Illusionen von einer Karriere als Musiker; eine künstlerische Ambition, die sich Jahre später in den photografischen Gehversuchen seines Sohnes widerspiegelt. Die Parallelen, die der episodische Plot zwischen Einst und Jetzt zieht, sind so offenkundig, dass es ihre Signifikanz eher untergräbt als zu unterstreichen. So banal ist die Entwicklung der Geschichte und ihrer Figuren, dass alles vermeintlich psychologisch Angebahnte ebenso gut reiner Zufall sein könnte. Die Belanglosigkeit des filmischen Familienalbums voll sentimentaler, intimer und, da dies in keiner dramatisierten Dia-Show fehlen darf, melancholischer Aufnahmen findet ihr adäquates Pendant in den turnusmäßig eingeworfenen populärkulturellen Fanalen. Wichtiger als ihre Funktion als chronologische Marksteine ist die als Köder für das Publikum, sich zu identifizieren: mit den Figuren, vor allem aber mit der Zeit, die der wahre Hauptakteur ist. Der erste Band „Harry Potter“, den die Mutter vorliest, führt dazu, dass alle schließlich um Mitternacht Schlange stehen, um einen der Folgebände zu erwerben. Weil es in der Welt da draußen noch ernstere Auseinandersetzungen gab als die des Zauberschülers, fallen bisweilen ein paar Worte über den Irak-Krieg. Ansonsten laufen Coldplay und irgendwann sogar Gotyes „Somebody that I used to know“.







