Hacksaw Ridge, USA/AU 2016 • 139 Min • Regie: Mel Gibson • Drehbuch: Robert Schenkkan, Andrew Knight • Mit: Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Luke Bracey • Kamera: Simon Duggan • Musik: Rupert Gregson-Williams • FSK: ab 16 Jahren • Verleih: Universum Film • Kinostart: 26.01.2017 • Heimkinostart: 9.06.2017 • Deutsche Website
 Eine ganze Dekade liegt jetzt zwischen „Apocalypto“ und Mel Gibsons folgender Regiearbeit „Hacksaw Ridge – Die Entscheidung“. Mit dem Erfolg oder der Qualität des intensiven Maya-Abenteuers hatte die lange Pause nichts zu tun, sondern vor allem mit einigen handfesten Skandalen, die das Multitalent überschatteten. Nach einem antisemitischen Ausbruch landete der Oscar-Preisträger („Braveheart“) zunächst auf Hollywoods inoffizieller Blacklist, was im Prinzip bedeutet, dass vorerst kein Studio oder Produzent mehr ein Projekt mit ihm wagen möchte. Nicht zuletzt durch die gute Fürsprache einiger Schauspielerkollegen wurde „Mad Mel“ schließlich doch begnadigt und mit der wahren Geschichte des Feldsanitäters Desmond Doss betraut, der während der Schlacht um Okinawa mindestens 75 Kameraden das Leben rettete, ohne dabei je eine Waffe abgefeuert zu haben. Thematisch passt das Werk damit perfekt in die Filmografie Gibsons, die stark von Motiven des Glaubens, der Selbstaufopferung und der schonungslosen Gewalt geprägt ist. Ähnlich wie in seinem kontroversen „Die Passion Christi“ steht auch hier ein pazifistischer Mann im Mittelpunkt, der für seine Überzeugung bis in den Tod gehen würde.
Eine ganze Dekade liegt jetzt zwischen „Apocalypto“ und Mel Gibsons folgender Regiearbeit „Hacksaw Ridge – Die Entscheidung“. Mit dem Erfolg oder der Qualität des intensiven Maya-Abenteuers hatte die lange Pause nichts zu tun, sondern vor allem mit einigen handfesten Skandalen, die das Multitalent überschatteten. Nach einem antisemitischen Ausbruch landete der Oscar-Preisträger („Braveheart“) zunächst auf Hollywoods inoffizieller Blacklist, was im Prinzip bedeutet, dass vorerst kein Studio oder Produzent mehr ein Projekt mit ihm wagen möchte. Nicht zuletzt durch die gute Fürsprache einiger Schauspielerkollegen wurde „Mad Mel“ schließlich doch begnadigt und mit der wahren Geschichte des Feldsanitäters Desmond Doss betraut, der während der Schlacht um Okinawa mindestens 75 Kameraden das Leben rettete, ohne dabei je eine Waffe abgefeuert zu haben. Thematisch passt das Werk damit perfekt in die Filmografie Gibsons, die stark von Motiven des Glaubens, der Selbstaufopferung und der schonungslosen Gewalt geprägt ist. Ähnlich wie in seinem kontroversen „Die Passion Christi“ steht auch hier ein pazifistischer Mann im Mittelpunkt, der für seine Überzeugung bis in den Tod gehen würde.
 Gibson beginnt seine Geschichte in der Kindheit des 2006 verstorbenen Helden. Zusammen mit seinem Bruder Harold wächst Desmond in einer idyllischen Kleinstadtatmosphäre auf, die allerdings von den Launen seines durch die Erlebnisse im Ersten Weltkrieg traumatisierten Vaters Tom (Hugo Weaving) verdunkelt wird. Eine wilde Rauferei, während der er Harold schwer verletzt, prägt den Jungen nachhaltig und veranlasst ihn dazu, der Gewalt auch in seinem späteren Leben abzuschwören. Als überzeugter Christ und Pazifist verliebt sich der erwachsene Desmond (Andrew Garfield) letztlich in die Krankenschwester Dorothy (Teresa Palmer), durch die sein Interesse am medizinischen Handwerk zusätzlich befeuert wird. Die fast bilderbuchartige Romanze wird von der zunehmenden Involvierung der USA in den Zweiten Weltkrieg scharf unterbrochen: Wie Harold und unzählige junge Amerikaner, möchte auch Desmond seinem Land dienen und schreibt sich bei der Armee ein – allerdings unter der Voraussetzung, dass er lediglich als Sanitäter eingesetzt wird und keine anderen Menschen töten muss. Während der Ausbildung werden seine Ideale auf eine harte Probe gestellt, denn nicht nur sein Vorgesetzter Sergeant Howell (Vince Vaughn), sondern auch seine übrigen Kameraden halten seine strikte Gewaltablehnung für pure Feigheit und trauen ihm keine sichere Unterstützung unter Gefecht zu. Trotz Widrigkeiten von allen Seiten wird der unbewaffnete Retter schließlich beim Kampf um das Felsplateau vom Maeda eingesetzt. Eine Mission, die den Männern die Hölle auf Erden vor Augen führt – doch Desmond steht zu seinem Wort und vollbringt eine unglaubliche Tat …
Gibson beginnt seine Geschichte in der Kindheit des 2006 verstorbenen Helden. Zusammen mit seinem Bruder Harold wächst Desmond in einer idyllischen Kleinstadtatmosphäre auf, die allerdings von den Launen seines durch die Erlebnisse im Ersten Weltkrieg traumatisierten Vaters Tom (Hugo Weaving) verdunkelt wird. Eine wilde Rauferei, während der er Harold schwer verletzt, prägt den Jungen nachhaltig und veranlasst ihn dazu, der Gewalt auch in seinem späteren Leben abzuschwören. Als überzeugter Christ und Pazifist verliebt sich der erwachsene Desmond (Andrew Garfield) letztlich in die Krankenschwester Dorothy (Teresa Palmer), durch die sein Interesse am medizinischen Handwerk zusätzlich befeuert wird. Die fast bilderbuchartige Romanze wird von der zunehmenden Involvierung der USA in den Zweiten Weltkrieg scharf unterbrochen: Wie Harold und unzählige junge Amerikaner, möchte auch Desmond seinem Land dienen und schreibt sich bei der Armee ein – allerdings unter der Voraussetzung, dass er lediglich als Sanitäter eingesetzt wird und keine anderen Menschen töten muss. Während der Ausbildung werden seine Ideale auf eine harte Probe gestellt, denn nicht nur sein Vorgesetzter Sergeant Howell (Vince Vaughn), sondern auch seine übrigen Kameraden halten seine strikte Gewaltablehnung für pure Feigheit und trauen ihm keine sichere Unterstützung unter Gefecht zu. Trotz Widrigkeiten von allen Seiten wird der unbewaffnete Retter schließlich beim Kampf um das Felsplateau vom Maeda eingesetzt. Eine Mission, die den Männern die Hölle auf Erden vor Augen führt – doch Desmond steht zu seinem Wort und vollbringt eine unglaubliche Tat …
 „Hacksaw Ridge“ lässt sich zunächst klar in drei Abschnitte unterteilen: Da wäre zuerst die Vorgeschichte von Desmond Doss, die einen näher an seinen Charakter, sein Umfeld und die Wurzeln seiner Überzeugung heranführt. Was Mel Gibson hier präsentiert, ist nicht bloß visuell klassisches Hollywood-Kino in Reinform – auch unter den wunderschönen und warmen Aufnahmen von Kameramann Simon Duggan („Der große Gatsby“) verbirgt sich die sehr traditionelle Schilderung einer Familie mit einem tiefen Riss und die Beobachtung einer zarten Liebe, die mit ihrer naiven Darstellung eine sympathische Prise Kitsch versprüht. Die unerfahrene und doch entschlossene Art, mit der sich Andrew Garfield („The Amazing Spider-Man“) seinem weiblichen (Film-)Gegenüber nähert, verrät mehr über dessen Figur, als der folgende erbarmungslose Drill und die Auseinandersetzung mit der Truppe. Er wirkt in diesen ruhigen Momenten einerseits wie ein Kind, das noch nicht wirklich auf die harten Schläge der Realität (oder in diesem Fall die sanften Herausforderungen der Liebe) vorbereitet ist, und hat doch andererseits sehr genaue Vorstellungen davon, was er will und was nicht.
„Hacksaw Ridge“ lässt sich zunächst klar in drei Abschnitte unterteilen: Da wäre zuerst die Vorgeschichte von Desmond Doss, die einen näher an seinen Charakter, sein Umfeld und die Wurzeln seiner Überzeugung heranführt. Was Mel Gibson hier präsentiert, ist nicht bloß visuell klassisches Hollywood-Kino in Reinform – auch unter den wunderschönen und warmen Aufnahmen von Kameramann Simon Duggan („Der große Gatsby“) verbirgt sich die sehr traditionelle Schilderung einer Familie mit einem tiefen Riss und die Beobachtung einer zarten Liebe, die mit ihrer naiven Darstellung eine sympathische Prise Kitsch versprüht. Die unerfahrene und doch entschlossene Art, mit der sich Andrew Garfield („The Amazing Spider-Man“) seinem weiblichen (Film-)Gegenüber nähert, verrät mehr über dessen Figur, als der folgende erbarmungslose Drill und die Auseinandersetzung mit der Truppe. Er wirkt in diesen ruhigen Momenten einerseits wie ein Kind, das noch nicht wirklich auf die harten Schläge der Realität (oder in diesem Fall die sanften Herausforderungen der Liebe) vorbereitet ist, und hat doch andererseits sehr genaue Vorstellungen davon, was er will und was nicht.
 Mit einem etwas schroffen Übergang wendet sich der Film anschließend der Ausbildung von Desmond Doss zu, die in ihrer Inszenierung wie ein „Full Metal Jacket light“ anmutet und mit Vince Vaughn eine nicht sonderlich charismatische Kopie von R. Lee Ermeys beängstigendem Drill-Sergeant einführt. Es ist der wichtigste Abschnitt in dieser Story über Doss, die sein eigentliches Märtyrium schon vor den Einsatz auf dem Schlachtfeld verlegt: Nicht zufällig weckt dieser Mittelteil Erinnerungen an Gibsons „Die Passion Christi“, in dem sich Jesus ebenfalls mit Feinden aus der eigenen Lebensgemeinde konfrontiert sah und seinen steinigsten Weg nicht für sein Überleben, sondern für seine Überzeugungen beschreiten musste. Doch im Gegensatz zu dem ultrabrutalen Vorgängerwerk gelingt es dem Regisseur leider nicht, dass einem das Leid des Sanitäters ähnlich nahe geht wie das furchtbare Schicksal des Messias. Das liegt natürlich zum einen daran, dass der Widerstand von Seiten der Soldaten keinesfalls so kompromisslos ausfällt wie das Werk der Folterknechte. Zum anderen gibt sich Andrew Garfield zwar alle Mühe, seine Rolle mit Emotionen zu füllen, doch ist die Zeichnung dieses realen Individuums etwas farblos und flach geraten. Dieser Mangel zieht sich leider auch bis zum Kriegsschauplatz durch, auf dem wir Doss anfangs ohnmächtig, aber schließlich selbstlos helfend erleben. Es fehlt an zusätzlichen ambivalenten Gefühlsregungen, wie etwa nachvollziehbaren Zweifeln. Ohnehin verliert man ab der Ankunft auf der Felsplatte die Identifikationsfigur ein wenig aus den Augen.
Mit einem etwas schroffen Übergang wendet sich der Film anschließend der Ausbildung von Desmond Doss zu, die in ihrer Inszenierung wie ein „Full Metal Jacket light“ anmutet und mit Vince Vaughn eine nicht sonderlich charismatische Kopie von R. Lee Ermeys beängstigendem Drill-Sergeant einführt. Es ist der wichtigste Abschnitt in dieser Story über Doss, die sein eigentliches Märtyrium schon vor den Einsatz auf dem Schlachtfeld verlegt: Nicht zufällig weckt dieser Mittelteil Erinnerungen an Gibsons „Die Passion Christi“, in dem sich Jesus ebenfalls mit Feinden aus der eigenen Lebensgemeinde konfrontiert sah und seinen steinigsten Weg nicht für sein Überleben, sondern für seine Überzeugungen beschreiten musste. Doch im Gegensatz zu dem ultrabrutalen Vorgängerwerk gelingt es dem Regisseur leider nicht, dass einem das Leid des Sanitäters ähnlich nahe geht wie das furchtbare Schicksal des Messias. Das liegt natürlich zum einen daran, dass der Widerstand von Seiten der Soldaten keinesfalls so kompromisslos ausfällt wie das Werk der Folterknechte. Zum anderen gibt sich Andrew Garfield zwar alle Mühe, seine Rolle mit Emotionen zu füllen, doch ist die Zeichnung dieses realen Individuums etwas farblos und flach geraten. Dieser Mangel zieht sich leider auch bis zum Kriegsschauplatz durch, auf dem wir Doss anfangs ohnmächtig, aber schließlich selbstlos helfend erleben. Es fehlt an zusätzlichen ambivalenten Gefühlsregungen, wie etwa nachvollziehbaren Zweifeln. Ohnehin verliert man ab der Ankunft auf der Felsplatte die Identifikationsfigur ein wenig aus den Augen.
 Dass Mel Gibson nicht nur mit viel Herzblut inszeniert, sondern auch gerne viel Herzblut in seinen Bildern vergießt, unterstreicht auch seine neue Arbeit mit Nachdruck. Extremitäten, Gedärme und verweste Leichen sind das Erste, was einem entgegenschlägt, wenn sich der Rauch der Explosionen verzogen hat. Doch auch hier wird viel gezeigt, ohne dass die Szenen beim Zuschauer wirklich unter die Haut kriechen. „Hacksaw Ridge“ wirkt wie eine Auftragsarbeit, deren Thema Gibson zwar offensichtlich interessiert hat und bei der er sich seine explizite Härte bewahren konnte, doch im Vergleich zu seinen übrigen Filmen bleiben Dramatik und Schlagkraft leider spürbar auf der Strecke. Nicht falsch verstehen – auch hier gibt es Szenen, die wahnsinnig intensiv und fesselnd sind. Doch irgendwie ist diese mal deutlich andere Sicht auf das „Ereignis Krieg“ unterm Strich zu sehr auf Nummer sicher getrimmt und womöglich auch mit einem bewussten Blick auf die Preissaison in Angriff genommen worden. Der wahnwitzige Mut des Menschen Doss lässt sich zumindest definitiv nicht auf den Mut bei der Umsetzung von dessen Geschichte übertragen.
Dass Mel Gibson nicht nur mit viel Herzblut inszeniert, sondern auch gerne viel Herzblut in seinen Bildern vergießt, unterstreicht auch seine neue Arbeit mit Nachdruck. Extremitäten, Gedärme und verweste Leichen sind das Erste, was einem entgegenschlägt, wenn sich der Rauch der Explosionen verzogen hat. Doch auch hier wird viel gezeigt, ohne dass die Szenen beim Zuschauer wirklich unter die Haut kriechen. „Hacksaw Ridge“ wirkt wie eine Auftragsarbeit, deren Thema Gibson zwar offensichtlich interessiert hat und bei der er sich seine explizite Härte bewahren konnte, doch im Vergleich zu seinen übrigen Filmen bleiben Dramatik und Schlagkraft leider spürbar auf der Strecke. Nicht falsch verstehen – auch hier gibt es Szenen, die wahnsinnig intensiv und fesselnd sind. Doch irgendwie ist diese mal deutlich andere Sicht auf das „Ereignis Krieg“ unterm Strich zu sehr auf Nummer sicher getrimmt und womöglich auch mit einem bewussten Blick auf die Preissaison in Angriff genommen worden. Der wahnwitzige Mut des Menschen Doss lässt sich zumindest definitiv nicht auf den Mut bei der Umsetzung von dessen Geschichte übertragen.
Am Ende bleibt ein perfekt ausschauendes und souverän gespieltes Kriegsdrama, das seine Chance auf ein herausragendes Werk trotz einer entsprechenden Grundlage verpasst. Mel Gibson beweist nach seiner Abstinenz, dass er ein begnadeter Regisseur bleibt und ihm in Sachen wuchtiger Bilder kaum jemand etwas vormacht. Vielleicht hat dieses Mal das Drehbuch einfach nicht für einen stärkeren Effekt ausgereicht. Zumindest nicht bei mir.
Information zur Heimkinoveröffentlichung
Ab dem 9. Juni 2017 ist Hacksaw Ridge – Die Entscheidung im Verleih von Universum Film in deutscher und englischer Sprachfassung (mit wahlweise deutschen oder englischen Untertiteln) als DVD, Blu-ray und 4K UHD erhältlich.
Neben dem Hauptfilm liegen der DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung folgende Extras vor:
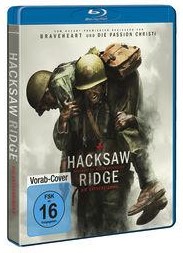 • The Soul of War: Making Hacksaw Ridge
• The Soul of War: Making Hacksaw Ridge
• Deleted Scenes
• Interviews mit Cast & Crew (nur Blu-ray)
(Cover © Universum Film)
Trailer



 Was Disney mit dem Marvel Cinematic Universe bewerkstelligt hat, ist in einem solchen Umfang einzigartig und wird lange als das Musterbeispiel eines erfolgreichen, gut durchdachten Film- und Serienuniversums gelten. Doch sie waren nicht die ersten. Bereits in den Vierzigern ließ Universal Frankensteins Monster, Dracula, den Wolfmenschen und andere Kreaturen aufeinander treffen. Der Vorwurf, Universal würde Marvels Strategie kopieren, ist daher unberechtigt, auch wenn Marvels Erfolg mit dem Konzept den Stein vermutlich ins Rollen gebracht hat. Für den Erfolg eines solchen Universums ist ein gelungener erster Film enorm wichtig und wäre Dracula Untold vor drei Jahren nicht als ein Kritiker- und Zuschauerflop untergegangen, wäre er vermutlich nicht von Universals Monsterfilm-Universum nachträglich verbannt worden. Bei Die Mumie gibt es nun keinen Weg zurück, denn wie der Film selbst, so konzentriert sich auch das Marketing mindestens genau so sehr auf das Filmuniversum wie auf den eigentlichen Plot des Streifens. Was Regisseur Alex Kurtzman und das Komitee von Autoren, durch deren Laptops und Schreibmaschinen das Skript zu Die Mumie über die letzten Jahren wanderte – darunter Christopher McQuarrie (
Was Disney mit dem Marvel Cinematic Universe bewerkstelligt hat, ist in einem solchen Umfang einzigartig und wird lange als das Musterbeispiel eines erfolgreichen, gut durchdachten Film- und Serienuniversums gelten. Doch sie waren nicht die ersten. Bereits in den Vierzigern ließ Universal Frankensteins Monster, Dracula, den Wolfmenschen und andere Kreaturen aufeinander treffen. Der Vorwurf, Universal würde Marvels Strategie kopieren, ist daher unberechtigt, auch wenn Marvels Erfolg mit dem Konzept den Stein vermutlich ins Rollen gebracht hat. Für den Erfolg eines solchen Universums ist ein gelungener erster Film enorm wichtig und wäre Dracula Untold vor drei Jahren nicht als ein Kritiker- und Zuschauerflop untergegangen, wäre er vermutlich nicht von Universals Monsterfilm-Universum nachträglich verbannt worden. Bei Die Mumie gibt es nun keinen Weg zurück, denn wie der Film selbst, so konzentriert sich auch das Marketing mindestens genau so sehr auf das Filmuniversum wie auf den eigentlichen Plot des Streifens. Was Regisseur Alex Kurtzman und das Komitee von Autoren, durch deren Laptops und Schreibmaschinen das Skript zu Die Mumie über die letzten Jahren wanderte – darunter Christopher McQuarrie ( Dabei hätte Die Mumie eigentlich genug zu bieten gehabt, wenn die Geschichte etwas fokussierter erzählt gewesen wäre und die Macher sich auf die Stärken des Films verlassen hätten. Zu diesen gehört zweifelsohne Tom Cruise, dessen Charakter hier nicht wie ein makelloser Held aus Jack Reacher oder Mission: Impossible beginnt, sondern eher an seine Figur aus
Dabei hätte Die Mumie eigentlich genug zu bieten gehabt, wenn die Geschichte etwas fokussierter erzählt gewesen wäre und die Macher sich auf die Stärken des Films verlassen hätten. Zu diesen gehört zweifelsohne Tom Cruise, dessen Charakter hier nicht wie ein makelloser Held aus Jack Reacher oder Mission: Impossible beginnt, sondern eher an seine Figur aus 

 Die Metamorphose des M. Night Shyamalan ist vollendet: Nach seinem herrlich-schrägen Low-Budget-Schocker
Die Metamorphose des M. Night Shyamalan ist vollendet: Nach seinem herrlich-schrägen Low-Budget-Schocker  Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein junger Mann (James McAvoy). Allerdings einer, dessen Körper von stolzen 23 Persönlichkeiten geteilt wird. Sein Name ist Kevin – beziehungsweise Dennis, Patricia, Hedwig, Barry et cetera – und er (oder sie) führt (oder führen) etwas ganz Finsteres im Schilde: Nach einer Geburtstagsfeier verschleppt er die Teenagerinnen Casey (Anya Taylor-Joy), Claire (Haley Lu Richardson) und Marcia (Jessica Sula) und bringt sie in sein isoliertes Versteck. Dort werden die verstörten Mädchen zunächst mit der Eigenart ihres geheimnisvollen Entführers vertraut, der sie als auserwählte Beute einer als „Bestie“ bezeichneten Entität ausweist. Der erste Fluchtversuch aus dem kargen Raum misslingt, weshalb die drei schließlich voneinander getrennt werden. Die Außenseiterin Casey, die selbst auf dunkle Stellen in ihrem Leben zurückblickt, gibt sich weiterhin kämpferisch und versucht, eine Schwachstelle in ihrem gespaltenen Gegenüber auszunutzen. Die Zeit läuft, denn die „Bestie“ ist bereits auf dem Weg …
Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein junger Mann (James McAvoy). Allerdings einer, dessen Körper von stolzen 23 Persönlichkeiten geteilt wird. Sein Name ist Kevin – beziehungsweise Dennis, Patricia, Hedwig, Barry et cetera – und er (oder sie) führt (oder führen) etwas ganz Finsteres im Schilde: Nach einer Geburtstagsfeier verschleppt er die Teenagerinnen Casey (Anya Taylor-Joy), Claire (Haley Lu Richardson) und Marcia (Jessica Sula) und bringt sie in sein isoliertes Versteck. Dort werden die verstörten Mädchen zunächst mit der Eigenart ihres geheimnisvollen Entführers vertraut, der sie als auserwählte Beute einer als „Bestie“ bezeichneten Entität ausweist. Der erste Fluchtversuch aus dem kargen Raum misslingt, weshalb die drei schließlich voneinander getrennt werden. Die Außenseiterin Casey, die selbst auf dunkle Stellen in ihrem Leben zurückblickt, gibt sich weiterhin kämpferisch und versucht, eine Schwachstelle in ihrem gespaltenen Gegenüber auszunutzen. Die Zeit läuft, denn die „Bestie“ ist bereits auf dem Weg … Neben dem Kammerspiel, das sich zwischen dem Antagonisten und seinen Opfern zuträgt, weitet der Regisseur und Drehbuchautor das Geschehen außerdem auf das Verhältnis des gestörten Täters zu seiner Psychiaterin Dr. Karen Fletcher (Betty Buckley) aus. Diese nutzt ihren faszinierenden Patienten als Gegenstand ihrer Forschung, die von der Theorie ausgeht, dass Personen mit multiplen Persönlichkeiten mehr Kapazität ihres Gehirns verwenden und sogar zu übermenschlichen körperlichen Leistungen fähig sein können. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht freilich ziemlicher Unfug, aber funktioniert in dem zwischen Schrecken und eigenwilliger Komik pendelnden Film als interessanter Aufhänger ausgezeichnet. „Split“ gibt sich keine Mühe, seine abgedrehte Idee verkrampft in der Realität zu verankern, sondern erschafft sich sein eigenes kleines Universum – in das Shyamalan mit dem Nachfolger übrigens erneut eintauchen will.
Neben dem Kammerspiel, das sich zwischen dem Antagonisten und seinen Opfern zuträgt, weitet der Regisseur und Drehbuchautor das Geschehen außerdem auf das Verhältnis des gestörten Täters zu seiner Psychiaterin Dr. Karen Fletcher (Betty Buckley) aus. Diese nutzt ihren faszinierenden Patienten als Gegenstand ihrer Forschung, die von der Theorie ausgeht, dass Personen mit multiplen Persönlichkeiten mehr Kapazität ihres Gehirns verwenden und sogar zu übermenschlichen körperlichen Leistungen fähig sein können. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht freilich ziemlicher Unfug, aber funktioniert in dem zwischen Schrecken und eigenwilliger Komik pendelnden Film als interessanter Aufhänger ausgezeichnet. „Split“ gibt sich keine Mühe, seine abgedrehte Idee verkrampft in der Realität zu verankern, sondern erschafft sich sein eigenes kleines Universum – in das Shyamalan mit dem Nachfolger übrigens erneut eintauchen will. Die ganz große Attraktion des auf billige Effekte vollständig verzichtenden Films hört natürlich auf den Namen James McAvoy (
Die ganz große Attraktion des auf billige Effekte vollständig verzichtenden Films hört natürlich auf den Namen James McAvoy ( • Alternatives Ende
• Alternatives Ende
 In meiner
In meiner  Viele werden Wonder Woman als eine Mischung aus Marvels erstem Captain America, der ebenfalls einen idealistischen Helden in die Wirren des (Zweiten) Weltkriegs schickte, und dem ersten Thor-Abenteuer, in dem ein Gott unter die Menschen kommt, sehen. Beide Vergleiche sind naheliegend, insbesondere zu Captain America, da hier nicht nur die Ähnlichkeit zwischen dem Retro-Schauplatz und der moralisch unfehlbaren Veranlagung der Hauptfiguren besteht, sondern auch zwischen den jeweiligen romantischen Partnern, die in beiden Fällen für den Geheimdienst tätig sind und sich durchaus auch ohne ihre Beschützer behaupten können (auch wenn ich bezweifle, dass Steve Trevor bald eine eigene Fernsehserie bekommen wird). Jedoch findet Wonder Woman in seinem Stil, seinen Themen und seiner Charakterisierung seine eigene Identität fernab dieser Vergleiche. Im Gegensatz zum Donnergott ist Diana Prince kein überheblicher Hitzkopf, der Demut erst noch lernen muss, und der Film wählte als Setting für die Auseinandersetzung mit der in allen Menschen vorhandenen dunklen Seite bewusst den Ersten Weltkrieg anstelle des Zweiten (wie in der Comicvorlage) aus, weil die Grenzen zwischen Gut und Böse damals noch deutlich verschwommener waren. Steve bringt dies in einer bewegenden Szene gut auf den Punkt, wenn er versucht, Diana klarzumachen, dass jeder möglicherweise Mitschuld an der Situation trägt, ihn eingeschlossen.
Viele werden Wonder Woman als eine Mischung aus Marvels erstem Captain America, der ebenfalls einen idealistischen Helden in die Wirren des (Zweiten) Weltkriegs schickte, und dem ersten Thor-Abenteuer, in dem ein Gott unter die Menschen kommt, sehen. Beide Vergleiche sind naheliegend, insbesondere zu Captain America, da hier nicht nur die Ähnlichkeit zwischen dem Retro-Schauplatz und der moralisch unfehlbaren Veranlagung der Hauptfiguren besteht, sondern auch zwischen den jeweiligen romantischen Partnern, die in beiden Fällen für den Geheimdienst tätig sind und sich durchaus auch ohne ihre Beschützer behaupten können (auch wenn ich bezweifle, dass Steve Trevor bald eine eigene Fernsehserie bekommen wird). Jedoch findet Wonder Woman in seinem Stil, seinen Themen und seiner Charakterisierung seine eigene Identität fernab dieser Vergleiche. Im Gegensatz zum Donnergott ist Diana Prince kein überheblicher Hitzkopf, der Demut erst noch lernen muss, und der Film wählte als Setting für die Auseinandersetzung mit der in allen Menschen vorhandenen dunklen Seite bewusst den Ersten Weltkrieg anstelle des Zweiten (wie in der Comicvorlage) aus, weil die Grenzen zwischen Gut und Böse damals noch deutlich verschwommener waren. Steve bringt dies in einer bewegenden Szene gut auf den Punkt, wenn er versucht, Diana klarzumachen, dass jeder möglicherweise Mitschuld an der Situation trägt, ihn eingeschlossen. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass der Film keine sehr eindeutigen Bösewichte hat. Danny Huston ist ein eindimensionaler Schurke alter Schule (dessen Figur übrigens eine reale Person im Ersten Weltkrieg war, wobei sich der Film einige, ähm, Freiheiten bei der Darstellung herausnimmt), der den Part jedoch so vergnüglich böse mit einer unerwarteten Sadismus-Spitze in einer Szene spielt, dass man ihm wirklich gerne dabei zuschaut. Elena Anaya, deren Gesichtsmaske so aussieht, als hätte sie ihre Rolle in der Drehpause zu Almodóvars Die Haut, in der ich wohne absolviert, ist leider unterfordert, hat jedoch immerhin eine gute Szene mit Chris Pine, in der sie mit ihrer stillen Mimik alleine mehr Emotionen ausdrückt, als in allen ihren anderen Szenen zusammen. Saïd Taghmaoui, Ewen Bremner und Eugene Brave Rock werden als Kriegsgefährten von Diana und Steve mit ihren eigenen Problemen eingeführt (Rassismus, PTSD, Vernichtung der indianischen Kultur durch Weiße), bleiben für die Handlung jedoch gänzlich unerheblich.
Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass der Film keine sehr eindeutigen Bösewichte hat. Danny Huston ist ein eindimensionaler Schurke alter Schule (dessen Figur übrigens eine reale Person im Ersten Weltkrieg war, wobei sich der Film einige, ähm, Freiheiten bei der Darstellung herausnimmt), der den Part jedoch so vergnüglich böse mit einer unerwarteten Sadismus-Spitze in einer Szene spielt, dass man ihm wirklich gerne dabei zuschaut. Elena Anaya, deren Gesichtsmaske so aussieht, als hätte sie ihre Rolle in der Drehpause zu Almodóvars Die Haut, in der ich wohne absolviert, ist leider unterfordert, hat jedoch immerhin eine gute Szene mit Chris Pine, in der sie mit ihrer stillen Mimik alleine mehr Emotionen ausdrückt, als in allen ihren anderen Szenen zusammen. Saïd Taghmaoui, Ewen Bremner und Eugene Brave Rock werden als Kriegsgefährten von Diana und Steve mit ihren eigenen Problemen eingeführt (Rassismus, PTSD, Vernichtung der indianischen Kultur durch Weiße), bleiben für die Handlung jedoch gänzlich unerheblich. Zum Glück kann man das von Chris Pines Steve Trevor nicht behaupten. Er hat die Love-Interest-Rolle, welche in solchen Filmen in der Regel Frauen vorbehalten ist, die aber zum Glück vielschichtiger geschrieben ist, als man dies von den meisten analogen Frauenrollen leider behaupten kann. Pine füllt die Rolle mit ähnlichem Charme, Leichtigkeit und Großspurigkeit aus, wie bei seinen Auftritten auf der Kommandobrücke der Enterprise, doch er gräbt noch tiefer und bringt die Erschöpfung und die Spuren zum Vorschein, die der Krieg bei ihm hinterlassen hat. Auf diese Weise bildet er einen gelungenen Kontrast zur unschuldig naiven, die Welt in Schwarz und Weiß sehenden Heldin. Beide stellen sich als essentiell für die Entwicklung ihres Gegenübers heraus. Gadot und Pine harmonieren miteinander und entwickeln schnell unwiderstehliche Chemie. Gerade im ersten Filmdrittel führt das zu einigen sehr amüsanten und an Anspielungen und Doppeldeutigkeiten reichen Momenten, wenn Diana den splitternackten Trevor ("überdurchschnittlich") beim Baden erwischt oder ihm sehr sachlich von ihrem umfassenden Wissen um die menschlichen Fortpflanzungsmechanismen erklärt.
Zum Glück kann man das von Chris Pines Steve Trevor nicht behaupten. Er hat die Love-Interest-Rolle, welche in solchen Filmen in der Regel Frauen vorbehalten ist, die aber zum Glück vielschichtiger geschrieben ist, als man dies von den meisten analogen Frauenrollen leider behaupten kann. Pine füllt die Rolle mit ähnlichem Charme, Leichtigkeit und Großspurigkeit aus, wie bei seinen Auftritten auf der Kommandobrücke der Enterprise, doch er gräbt noch tiefer und bringt die Erschöpfung und die Spuren zum Vorschein, die der Krieg bei ihm hinterlassen hat. Auf diese Weise bildet er einen gelungenen Kontrast zur unschuldig naiven, die Welt in Schwarz und Weiß sehenden Heldin. Beide stellen sich als essentiell für die Entwicklung ihres Gegenübers heraus. Gadot und Pine harmonieren miteinander und entwickeln schnell unwiderstehliche Chemie. Gerade im ersten Filmdrittel führt das zu einigen sehr amüsanten und an Anspielungen und Doppeldeutigkeiten reichen Momenten, wenn Diana den splitternackten Trevor ("überdurchschnittlich") beim Baden erwischt oder ihm sehr sachlich von ihrem umfassenden Wissen um die menschlichen Fortpflanzungsmechanismen erklärt. Klipp und klar gesagt: Wonder Woman ist die beste DC-Comicverfilmung seit
Klipp und klar gesagt: Wonder Woman ist die beste DC-Comicverfilmung seit  Doch solche Drehbuchschwächen kommen eigentlich in den meisten großen Blockbustern vor und haben mein Vergnügen nicht geschmälert. Jedoch hat sich Wonder Woman noch nicht gänzlich von allen Altlasten seiner DC-Vorgänger befreit und diese kommen im letzten Akt, insbesondere beim finalen Showdown, zum Tragen. Es ist als ob Jenkins vorgeschrieben wurde, dass jede DC-Verfilmung mit einem destruktiven, CGI-trächtigen, Over-the-Top-Showdown zu enden hat, der trotz (oder gerade wegen) seines Bombasts die schwächste Actionszene des Films darstellt und mich leider an den Doomsday-Kampf am Ende von
Doch solche Drehbuchschwächen kommen eigentlich in den meisten großen Blockbustern vor und haben mein Vergnügen nicht geschmälert. Jedoch hat sich Wonder Woman noch nicht gänzlich von allen Altlasten seiner DC-Vorgänger befreit und diese kommen im letzten Akt, insbesondere beim finalen Showdown, zum Tragen. Es ist als ob Jenkins vorgeschrieben wurde, dass jede DC-Verfilmung mit einem destruktiven, CGI-trächtigen, Over-the-Top-Showdown zu enden hat, der trotz (oder gerade wegen) seines Bombasts die schwächste Actionszene des Films darstellt und mich leider an den Doomsday-Kampf am Ende von 





 In Alexandre Ajas „Das 9. Leben des Louis Drax“ ist nichts, wie es zunächst scheint. Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Liz Jensen entwirft der französische Horror-Profi (u.a. „High Tension“ und „The Hills Have Eyes“) ein faszinierendes Mysterium um einen neunjährigen Jungen, der einen vermeintlich tödlichen Sturz wie durch ein Wunder überlebt und seitdem im Koma liegt. Ohne Blutfontänen oder billige Schockmomente nimmt sich das Werk Zeit, die Beziehungen der Figuren auszuloten und zunehmend fantastische Elemente in die Geschichte einzuflechten. Dabei gelingt es dem Regisseur zwar nicht durchgehend, den Wechsel zwischen tragischen, erschreckenden und skurrilen Passagen besonders elegant zu meistern, doch das Resultat am Ende stimmt: Der ambitionierte Film nimmt einen undurchsichtigen und vertrackten Weg in Kauf, um die Zuschauer letztlich mit der emotionalen Faust unvermittelt und brutal zu treffen.
In Alexandre Ajas „Das 9. Leben des Louis Drax“ ist nichts, wie es zunächst scheint. Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Liz Jensen entwirft der französische Horror-Profi (u.a. „High Tension“ und „The Hills Have Eyes“) ein faszinierendes Mysterium um einen neunjährigen Jungen, der einen vermeintlich tödlichen Sturz wie durch ein Wunder überlebt und seitdem im Koma liegt. Ohne Blutfontänen oder billige Schockmomente nimmt sich das Werk Zeit, die Beziehungen der Figuren auszuloten und zunehmend fantastische Elemente in die Geschichte einzuflechten. Dabei gelingt es dem Regisseur zwar nicht durchgehend, den Wechsel zwischen tragischen, erschreckenden und skurrilen Passagen besonders elegant zu meistern, doch das Resultat am Ende stimmt: Der ambitionierte Film nimmt einen undurchsichtigen und vertrackten Weg in Kauf, um die Zuschauer letztlich mit der emotionalen Faust unvermittelt und brutal zu treffen. Louis Drax (Aiden Longworth) ist alles andere als ein gewöhnliches Kind. Seit seiner schwierigen Geburt übersteht er im Jahrestakt bedrohliche Ereignisse – Unfälle, Insektenstiche und Infektionen sind mannigfaltig in seiner kurzen Vita vertreten. Seine Mutter Natalie (Sarah Gadon) und sein Vater Peter (Aaron Paul) befinden sich in einer Ehekrise, die durch den jüngsten Zwischenfall mit ihrem Sohn ihren Höhepunkt findet: An seinem neunten Geburtstag stürzt Louis während eines Familienpicknicks von einer Klippe. Infolge eines aufwändigen Einsatzes wird der Junge aus den Fluten geborgen, aber im Krankenhaus für tot erklärt – bis schließlich in der Leichenhalle die Überraschung groß ist, dass die Feststellung des Arztes offensichtlich falsch war. Louis lebt und befindet sich im Koma, während von seinem Vater seit dem Vorfall jede Spur fehlt. Hat Peter Drax womöglich etwas mit dem Sturz zu tun? Der Spezialist Dr. Allan Pascal (Jamie Dornan) wird mit dem sonderbaren Fall betraut, der ihn immer tiefer in die Vergangenheit und das Wesen seines Patienten hineinzieht. Langsam entwickelt sich zwischen ihm und Natalie eine tiefere Zuneigung, doch einige beunruhigende Geschehnisse verweisen stetig auf eine düstere Wahrheit …
Louis Drax (Aiden Longworth) ist alles andere als ein gewöhnliches Kind. Seit seiner schwierigen Geburt übersteht er im Jahrestakt bedrohliche Ereignisse – Unfälle, Insektenstiche und Infektionen sind mannigfaltig in seiner kurzen Vita vertreten. Seine Mutter Natalie (Sarah Gadon) und sein Vater Peter (Aaron Paul) befinden sich in einer Ehekrise, die durch den jüngsten Zwischenfall mit ihrem Sohn ihren Höhepunkt findet: An seinem neunten Geburtstag stürzt Louis während eines Familienpicknicks von einer Klippe. Infolge eines aufwändigen Einsatzes wird der Junge aus den Fluten geborgen, aber im Krankenhaus für tot erklärt – bis schließlich in der Leichenhalle die Überraschung groß ist, dass die Feststellung des Arztes offensichtlich falsch war. Louis lebt und befindet sich im Koma, während von seinem Vater seit dem Vorfall jede Spur fehlt. Hat Peter Drax womöglich etwas mit dem Sturz zu tun? Der Spezialist Dr. Allan Pascal (Jamie Dornan) wird mit dem sonderbaren Fall betraut, der ihn immer tiefer in die Vergangenheit und das Wesen seines Patienten hineinzieht. Langsam entwickelt sich zwischen ihm und Natalie eine tiefere Zuneigung, doch einige beunruhigende Geschehnisse verweisen stetig auf eine düstere Wahrheit … Schon mit dem Vorgänger „Horns“ (2013) hat sich Alexandre Aja einen vielschichtigen Stoff für seine Abkehr von den expliziten Hardcore-Wurzeln ausgesucht. Ähnlich wie bei der Joe-Hill-Adaption hat der passionierte Genre-Liebhaber auch hier seine Probleme damit, die verschiedenen Stimmungen aus der Literaturvorlage als ein in sich völlig homogenes Ganzes umzusetzen. „Das 9. Leben des Louis Drax“ beginnt wie eine tiefschwarze Komödie und entpuppt sich im Verlauf als mit magischem Realismus und parapsychologischen Ansätzen angereichertes Familiendrama im Thriller-Gewand. Klingt abgedreht? Ist es definitiv auch – allerdings schafft es Aja, dass einen diese abenteuerliche Konstruktion direkt packt und bis zum Schluss nicht mehr loslässt. Gründe dafür sind, neben der knackigen Inszenierung, die vielen lebhaften Charaktere, deren Verhältnis zueinander das größte Geheimnis beherbergt. Welcher Konflikt besteht wirklich zwischen Natalie und Peter? Welche Rolle spielt der als „fetter Perez“ (Oliver Platt) bezeichnete Psychiater des Kindes? Und wie steht der in seinem Verhalten deutlich auffällige Louis tatsächlich zu seinem Umfeld? Man sollte nicht den Fehler begehen, den Film lediglich aus dem Blickwinkel des Jungen, der als Kommentator aus dem Koma und in Rückblenden in Aktion tritt, zu betrachten. Kinder sagen zwar bekanntlich immer die Wahrheit, doch die Frage ist, wie ein Kind die Wahrheit interpretiert. Der einzige Charakter, der erst im Anschluss an das fatale Ereignis in die Erzählung stößt und sich als Außenstehender am ehesten als Identifikationsfigur anbietet, ist der mit innovativen Methoden praktizierende Dr. Pascal. Worauf die Geschichte letztlich hinausläuft, bleibt trotz diverser Hinweise ein Rätsel.
Schon mit dem Vorgänger „Horns“ (2013) hat sich Alexandre Aja einen vielschichtigen Stoff für seine Abkehr von den expliziten Hardcore-Wurzeln ausgesucht. Ähnlich wie bei der Joe-Hill-Adaption hat der passionierte Genre-Liebhaber auch hier seine Probleme damit, die verschiedenen Stimmungen aus der Literaturvorlage als ein in sich völlig homogenes Ganzes umzusetzen. „Das 9. Leben des Louis Drax“ beginnt wie eine tiefschwarze Komödie und entpuppt sich im Verlauf als mit magischem Realismus und parapsychologischen Ansätzen angereichertes Familiendrama im Thriller-Gewand. Klingt abgedreht? Ist es definitiv auch – allerdings schafft es Aja, dass einen diese abenteuerliche Konstruktion direkt packt und bis zum Schluss nicht mehr loslässt. Gründe dafür sind, neben der knackigen Inszenierung, die vielen lebhaften Charaktere, deren Verhältnis zueinander das größte Geheimnis beherbergt. Welcher Konflikt besteht wirklich zwischen Natalie und Peter? Welche Rolle spielt der als „fetter Perez“ (Oliver Platt) bezeichnete Psychiater des Kindes? Und wie steht der in seinem Verhalten deutlich auffällige Louis tatsächlich zu seinem Umfeld? Man sollte nicht den Fehler begehen, den Film lediglich aus dem Blickwinkel des Jungen, der als Kommentator aus dem Koma und in Rückblenden in Aktion tritt, zu betrachten. Kinder sagen zwar bekanntlich immer die Wahrheit, doch die Frage ist, wie ein Kind die Wahrheit interpretiert. Der einzige Charakter, der erst im Anschluss an das fatale Ereignis in die Erzählung stößt und sich als Außenstehender am ehesten als Identifikationsfigur anbietet, ist der mit innovativen Methoden praktizierende Dr. Pascal. Worauf die Geschichte letztlich hinausläuft, bleibt trotz diverser Hinweise ein Rätsel. Auch wenn sich das Werk stilistisch deutlich von den brachialen Anfängen des Regisseurs unterscheidet, steht hier ein Thema im Mittelpunkt, dem schon in jeder seiner vorherigen Arbeiten eine besondere Rolle zukam: Die Familie. Streift man nach Sichtung sämtliche Fantastik ab, bleibt ein berührendes und mit seinem ernsten Hintergrund erschütterndes Bild haften. Monster gibt es in der Wirklichkeit ebenso wenig wie Menschen, die nur gut oder böse sind. Während einen die Psychokiller, Kannibalen, Spiegel und gefräßigen Fische aus Ajas Vorgängern nur für den Moment verängstigt haben, wirkt die verstörende Auflösung von „Das 9. Leben des Louis Drax“ nach. Dieses verzauberte Gewässer verbirgt unter seiner Oberfläche finstere Abgründe.
Auch wenn sich das Werk stilistisch deutlich von den brachialen Anfängen des Regisseurs unterscheidet, steht hier ein Thema im Mittelpunkt, dem schon in jeder seiner vorherigen Arbeiten eine besondere Rolle zukam: Die Familie. Streift man nach Sichtung sämtliche Fantastik ab, bleibt ein berührendes und mit seinem ernsten Hintergrund erschütterndes Bild haften. Monster gibt es in der Wirklichkeit ebenso wenig wie Menschen, die nur gut oder böse sind. Während einen die Psychokiller, Kannibalen, Spiegel und gefräßigen Fische aus Ajas Vorgängern nur für den Moment verängstigt haben, wirkt die verstörende Auflösung von „Das 9. Leben des Louis Drax“ nach. Dieses verzauberte Gewässer verbirgt unter seiner Oberfläche finstere Abgründe.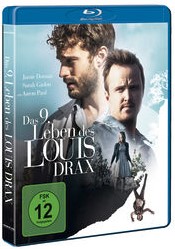


 Das Äußere ist nicht alles, was zählt. Schon bei
Das Äußere ist nicht alles, was zählt. Schon bei  Bevor die Handlung mit einer neuen Crew einsetzt, wirft der Film zunächst einen Blick zurück auf David (Michael Fassbender), der von seinem Entwickler Weyland (Guy Pearce) mit seinen Aufgaben vertraut gemacht wird. Unter den autoritären Worten des Menschen beginnt die Maschine, den nicht unwesentlichen Unterschied zwischen beiden anzumerken: Die menschliche Sterblichkeit. Wozu der offensichtlich mit einem Gottkomplex ausgestattete Android imstande ist, soll er im Verlauf des Vorgängerwerkes demonstrieren, in dem er einem Bordmitglied eine gefährliche außerirdische Substanz einflößt, die den Schrecken weiter in Gang setzt. David steht auch im Zentrum dieser Geschichte um die Besatzung des Kolonieschiffs „Covenant“, das sich auf Kurs zu einem erdähnlichen Planeten befindet. Durch einen fatalen Zwischenfall werden Teile der Anwesenden getötet, während der Rest vorzeitig aus dem künstlichen Schlaf erweckt wird. Nach dem Empfang eines mysteriösen Funkspruchs von einem nahe gelegenen Teil der Galaxie, entscheidet der neue Captain Oram (Billy Crudup), die Mission zu unterbrechen und diesem Signal zu folgen. Scheinbar hält auch dieser unbekannte Ort die optimalen Lebensbedingungen für eine Besiedlung bereit. Was er und sein Team, zu dem auch die toughe Daniels (Katherine Waterston) und der Android Walter (ebenfalls Fassbender) gehören, nicht ahnen, ist, dass in der verlassenen Landschaft eine todbringende Gefahr lauert. Und dann erscheint plötzlich David als Retter in der Not …
Bevor die Handlung mit einer neuen Crew einsetzt, wirft der Film zunächst einen Blick zurück auf David (Michael Fassbender), der von seinem Entwickler Weyland (Guy Pearce) mit seinen Aufgaben vertraut gemacht wird. Unter den autoritären Worten des Menschen beginnt die Maschine, den nicht unwesentlichen Unterschied zwischen beiden anzumerken: Die menschliche Sterblichkeit. Wozu der offensichtlich mit einem Gottkomplex ausgestattete Android imstande ist, soll er im Verlauf des Vorgängerwerkes demonstrieren, in dem er einem Bordmitglied eine gefährliche außerirdische Substanz einflößt, die den Schrecken weiter in Gang setzt. David steht auch im Zentrum dieser Geschichte um die Besatzung des Kolonieschiffs „Covenant“, das sich auf Kurs zu einem erdähnlichen Planeten befindet. Durch einen fatalen Zwischenfall werden Teile der Anwesenden getötet, während der Rest vorzeitig aus dem künstlichen Schlaf erweckt wird. Nach dem Empfang eines mysteriösen Funkspruchs von einem nahe gelegenen Teil der Galaxie, entscheidet der neue Captain Oram (Billy Crudup), die Mission zu unterbrechen und diesem Signal zu folgen. Scheinbar hält auch dieser unbekannte Ort die optimalen Lebensbedingungen für eine Besiedlung bereit. Was er und sein Team, zu dem auch die toughe Daniels (Katherine Waterston) und der Android Walter (ebenfalls Fassbender) gehören, nicht ahnen, ist, dass in der verlassenen Landschaft eine todbringende Gefahr lauert. Und dann erscheint plötzlich David als Retter in der Not … Beginnen wir mit den positiven Aspekten: Ridley Scott bleibt ein Meister der stimmungsvollen Bilder. Was er in „Alien: Covenant“ erneut mit seinem Kameramann Dariusz Wolski auf die Leinwand zaubert, könnte man sich auch zuhause im Rahmen an die Wand hängen. Vorausgesetzt, man steht auf düstere Kunst – denn dieses Sequel zum Prequel ist in Sachen Atmosphäre noch deutlich grimmiger geraten, als der schon nicht sonderlich sonnige Vorgänger. Dazu kommt ein Score des Australiers Jed Kurzel (
Beginnen wir mit den positiven Aspekten: Ridley Scott bleibt ein Meister der stimmungsvollen Bilder. Was er in „Alien: Covenant“ erneut mit seinem Kameramann Dariusz Wolski auf die Leinwand zaubert, könnte man sich auch zuhause im Rahmen an die Wand hängen. Vorausgesetzt, man steht auf düstere Kunst – denn dieses Sequel zum Prequel ist in Sachen Atmosphäre noch deutlich grimmiger geraten, als der schon nicht sonderlich sonnige Vorgänger. Dazu kommt ein Score des Australiers Jed Kurzel ( Und somit kommen wir zu den Kritikpunkten, die leider deutlich überwiegen. Ich möchte zunächst anmerken: Es kommt selten vor, dass ich mich in Blockbustern über die Blödheit von Figuren ernsthaft ärgere. So hat mich der indiskutable Dutzidutziduu-kleine-Weltraumschlange-Moment in
Und somit kommen wir zu den Kritikpunkten, die leider deutlich überwiegen. Ich möchte zunächst anmerken: Es kommt selten vor, dass ich mich in Blockbustern über die Blödheit von Figuren ernsthaft ärgere. So hat mich der indiskutable Dutzidutziduu-kleine-Weltraumschlange-Moment in  Und es fällt: All das, was der Vorgänger an interessanten Anschluss- und Erklärungsmöglichkeiten angeboten hatte, wird in „Alien: Covenant“ nicht genutzt. Man muss sich das in etwa so vorstellen: In
Und es fällt: All das, was der Vorgänger an interessanten Anschluss- und Erklärungsmöglichkeiten angeboten hatte, wird in „Alien: Covenant“ nicht genutzt. Man muss sich das in etwa so vorstellen: In 
 Ein Studentenleben kann die Hölle sein: Weg aus dem behüteten Elternhaus, rein in eine schäbige Bruchbude. Neues Umfeld. Harte Prüfungen. Und das alles auf einmal. In Julia Ducournaus kontroversem Spielfilmdebüt „Raw“ steht dieser Abschnitt metaphorisch für den Beginn von Veränderungen verschiedenster Art – auch körperlicher. Die junge Französin entwirft in ihrer Coming-of-Age-Geschichte ein groteskes Szenario, das wie eine im Fiebertraum verzerrte Realität anmutet. Selbst wenn das Werk Body-Horror-Elemente aufweist und das Tabuthema „Kannibalismus“ anschneidet, sollte man jedoch nicht den Fehler begehen, dieses als plumpes Genre-Kino abzutun. „Raw“ ist zu gleichen Teilen Drama, rabenschwarze Komödie und monströser Schocker, ohne auf diesem erzählerischen Drahtseil je die Balance zu verlieren – hoch über dem Einheitsbrei austauschbarer Produktionen schreitet die Regisseurin/Drehbuchautorin mit ihrer individuellen Vision sicher und mutig voran.
Ein Studentenleben kann die Hölle sein: Weg aus dem behüteten Elternhaus, rein in eine schäbige Bruchbude. Neues Umfeld. Harte Prüfungen. Und das alles auf einmal. In Julia Ducournaus kontroversem Spielfilmdebüt „Raw“ steht dieser Abschnitt metaphorisch für den Beginn von Veränderungen verschiedenster Art – auch körperlicher. Die junge Französin entwirft in ihrer Coming-of-Age-Geschichte ein groteskes Szenario, das wie eine im Fiebertraum verzerrte Realität anmutet. Selbst wenn das Werk Body-Horror-Elemente aufweist und das Tabuthema „Kannibalismus“ anschneidet, sollte man jedoch nicht den Fehler begehen, dieses als plumpes Genre-Kino abzutun. „Raw“ ist zu gleichen Teilen Drama, rabenschwarze Komödie und monströser Schocker, ohne auf diesem erzählerischen Drahtseil je die Balance zu verlieren – hoch über dem Einheitsbrei austauschbarer Produktionen schreitet die Regisseurin/Drehbuchautorin mit ihrer individuellen Vision sicher und mutig voran. Es ist ein Neustart für Justine (Garance Marillier), die nach einem herausragendem Schulabschluss in die Fußstapfen ihrer Eltern (Joana Preiss und Laurent Lucas) und ihrer älteren Schwester Alexia (Ella Rumpf) treten und an der Uni Veterinärmedizin studieren soll. Wie der Rest ihrer Familie ist auch sie überzeugte Vegetarierin – bis sie zusammen mit den anderen Erstsemestlern von den älteren Kommilitonen aus dem Bett gezerrt und zu einer Reihe bizarrer Aufnahmerituale genötigt wird. Unter anderem soll jeder eine rohe Hasenleber verzehren, wozu die schüchterne Justine zunächst nicht in der Lage ist, aber letztlich von der schroffen Alexia überredet wird. Offensichtlich hat ihre Schwester unlängst mit der strikt fleischfreien Vergangenheit gebrochen und sich in Abwesenheit der Erzeuger zum Karnivoren entwickelt. So soll es schließlich auch dem brillanten Wunderkind ergehen, denn nach einem quälenden Hautausschlag, der als mögliche allergische Reaktion auf das neue Nahrungsmittel gedeutet wird, giert auch Justine auf mysteriöse Weise nach frischem Fleisch. Zuerst wird in der Kantine ein Hamburger gemopst, dann der Kühlschrank ihres schwulen Mitbewohners Adrien (Rabah Naït Oufella) geplündert und letztlich landet nach einem kleinen Unfall gar ein menschlicher Überrest in ihrem Schlund. Für Alexia ist der Zeitpunkt gekommen, das noch unbeholfene Familienmitglied an der Hand zu nehmen und in ein finsteres Geheimnis einzuweihen …
Es ist ein Neustart für Justine (Garance Marillier), die nach einem herausragendem Schulabschluss in die Fußstapfen ihrer Eltern (Joana Preiss und Laurent Lucas) und ihrer älteren Schwester Alexia (Ella Rumpf) treten und an der Uni Veterinärmedizin studieren soll. Wie der Rest ihrer Familie ist auch sie überzeugte Vegetarierin – bis sie zusammen mit den anderen Erstsemestlern von den älteren Kommilitonen aus dem Bett gezerrt und zu einer Reihe bizarrer Aufnahmerituale genötigt wird. Unter anderem soll jeder eine rohe Hasenleber verzehren, wozu die schüchterne Justine zunächst nicht in der Lage ist, aber letztlich von der schroffen Alexia überredet wird. Offensichtlich hat ihre Schwester unlängst mit der strikt fleischfreien Vergangenheit gebrochen und sich in Abwesenheit der Erzeuger zum Karnivoren entwickelt. So soll es schließlich auch dem brillanten Wunderkind ergehen, denn nach einem quälenden Hautausschlag, der als mögliche allergische Reaktion auf das neue Nahrungsmittel gedeutet wird, giert auch Justine auf mysteriöse Weise nach frischem Fleisch. Zuerst wird in der Kantine ein Hamburger gemopst, dann der Kühlschrank ihres schwulen Mitbewohners Adrien (Rabah Naït Oufella) geplündert und letztlich landet nach einem kleinen Unfall gar ein menschlicher Überrest in ihrem Schlund. Für Alexia ist der Zeitpunkt gekommen, das noch unbeholfene Familienmitglied an der Hand zu nehmen und in ein finsteres Geheimnis einzuweihen … Nach Aufführungen auf diversen Festivals hat „Raw“ vor allem als der Film Furore gemacht, der aufgrund expliziter Ekelszenen diverse Zuschauer ohnmächtig vom Sessel kippen ließ. Gleich vorweg: Wer sich an ausgedehntem Splatter erfreuen möchte und etwas in Richtung des berüchtigten Kultwerkes „Cannibal Holocaust“ (1980) erwartet, wird hier entgegen der reißerischen Berichte nicht fündig werden. Möglicherweise haben die Opfer dieser reichlich wilden, aber sicher nicht ultrablutrünstigen, Arbeit bislang gedacht, dass in Frankreich lediglich Programmkino-Heiterkeiten à la „Willkommen bei den Sch’tis“ produziert würden und frühere Hardcore-Ware der Marke „Inside“ (2007) oder „Martyrs“ (2008) schlicht nicht zur Kenntnis genommen. Nicht die Schuld der aufregenden Newcomerin Ducournau, die übrigens keines dieser Lager bedient, sondern einen ganz eigenen Weg einschlägt. Als ihre größte Inspirationsquelle dienten dabei zweifellos die Frühwerke David Cronenbergs („Rabid“), wobei der Body-Horror-Aspekt in „Raw“ weitaus subtiler als bei dem kanadischen Genre-Urvater ausfällt. Während bei Cronenberg Körper oft auf erschreckendste Weise vollständig mutieren, sind die Veränderungen hier eher auf der Mikroebene zu finden: Etwa Hormone, die zu Lust führen oder Hautreaktionen hervorrufen, und Gene, die Träger mit spezifischen Eigenschaften ausstatten.
Nach Aufführungen auf diversen Festivals hat „Raw“ vor allem als der Film Furore gemacht, der aufgrund expliziter Ekelszenen diverse Zuschauer ohnmächtig vom Sessel kippen ließ. Gleich vorweg: Wer sich an ausgedehntem Splatter erfreuen möchte und etwas in Richtung des berüchtigten Kultwerkes „Cannibal Holocaust“ (1980) erwartet, wird hier entgegen der reißerischen Berichte nicht fündig werden. Möglicherweise haben die Opfer dieser reichlich wilden, aber sicher nicht ultrablutrünstigen, Arbeit bislang gedacht, dass in Frankreich lediglich Programmkino-Heiterkeiten à la „Willkommen bei den Sch’tis“ produziert würden und frühere Hardcore-Ware der Marke „Inside“ (2007) oder „Martyrs“ (2008) schlicht nicht zur Kenntnis genommen. Nicht die Schuld der aufregenden Newcomerin Ducournau, die übrigens keines dieser Lager bedient, sondern einen ganz eigenen Weg einschlägt. Als ihre größte Inspirationsquelle dienten dabei zweifellos die Frühwerke David Cronenbergs („Rabid“), wobei der Body-Horror-Aspekt in „Raw“ weitaus subtiler als bei dem kanadischen Genre-Urvater ausfällt. Während bei Cronenberg Körper oft auf erschreckendste Weise vollständig mutieren, sind die Veränderungen hier eher auf der Mikroebene zu finden: Etwa Hormone, die zu Lust führen oder Hautreaktionen hervorrufen, und Gene, die Träger mit spezifischen Eigenschaften ausstatten. Die Regisseurin ist besessen von dem, was äußere und innere Einflüsse mit dem Individuum anstellen. Nicht umsonst stellt sie den Studiumsantritt Justines wie eine Art von Geburt dar. Zu Beginn wirkt die junge Frau schutzlos, wie von den Eltern in einer Kristallkugel gefangen. Dieses imaginäre Gefäß zerbricht direkt in der ersten auswärtigen Nacht, in der sie gezwungen wird, buchstäblich auf allen vieren krabbelnd die unbekannte Umgebung wahrzunehmen. An der Uni wird sie schließlich mit allem konfrontiert, was einen heranwachsenden Menschen verändern und prägen kann: Neue soziale Kontakte, sexuelle Reize, geistige Herausforderungen, exzessive Partys, unterschiedliche Umgangsformen und auch Dinge, die zuvor undenkbar waren und nun wie die verbotene Frucht im Garten Eden lockend rufen. Aufmerksam beobachtet der Film die von der Newcomerin Garance Marillier sympathisch dargestellte Protagonistin und zeigt einen schleichenden Wandel in ihrem Verhalten auf. Im krassen Gegensatz steht die von Ella Rumpf („Tiger Girl“) verkörperte Alexia, die ihr mit ihren Erlebnissen ein Stück voraus ist und im Verlauf eine brutale Rivalität mit Justine entwickelt. Am Ende steht trotz determinierender Faktoren der freie Wille, mit dem man sein eigenes Handeln gestaltet.
Die Regisseurin ist besessen von dem, was äußere und innere Einflüsse mit dem Individuum anstellen. Nicht umsonst stellt sie den Studiumsantritt Justines wie eine Art von Geburt dar. Zu Beginn wirkt die junge Frau schutzlos, wie von den Eltern in einer Kristallkugel gefangen. Dieses imaginäre Gefäß zerbricht direkt in der ersten auswärtigen Nacht, in der sie gezwungen wird, buchstäblich auf allen vieren krabbelnd die unbekannte Umgebung wahrzunehmen. An der Uni wird sie schließlich mit allem konfrontiert, was einen heranwachsenden Menschen verändern und prägen kann: Neue soziale Kontakte, sexuelle Reize, geistige Herausforderungen, exzessive Partys, unterschiedliche Umgangsformen und auch Dinge, die zuvor undenkbar waren und nun wie die verbotene Frucht im Garten Eden lockend rufen. Aufmerksam beobachtet der Film die von der Newcomerin Garance Marillier sympathisch dargestellte Protagonistin und zeigt einen schleichenden Wandel in ihrem Verhalten auf. Im krassen Gegensatz steht die von Ella Rumpf („Tiger Girl“) verkörperte Alexia, die ihr mit ihren Erlebnissen ein Stück voraus ist und im Verlauf eine brutale Rivalität mit Justine entwickelt. Am Ende steht trotz determinierender Faktoren der freie Wille, mit dem man sein eigenes Handeln gestaltet. Der als knüppelharte Grenzerfahrung unzureichend beschriebene „Raw“ hat trotz einiger abstoßender Knabbereien und anderer Perversionen mehr als Kannibalenterror zu bieten. Unter der albtraumhaften Atmosphäre und dem prägnanten Score des Briten Jim Williams („Kill List“), der hier manchmal fast wie Dario Argentos Hausband Goblin losrockt, steckt eine Geschichte, die so sensibel, böse, komisch, tragisch, süß und irre wie das Erwachsenwerden selbst ist. Neben Robert Eggers (
Der als knüppelharte Grenzerfahrung unzureichend beschriebene „Raw“ hat trotz einiger abstoßender Knabbereien und anderer Perversionen mehr als Kannibalenterror zu bieten. Unter der albtraumhaften Atmosphäre und dem prägnanten Score des Briten Jim Williams („Kill List“), der hier manchmal fast wie Dario Argentos Hausband Goblin losrockt, steckt eine Geschichte, die so sensibel, böse, komisch, tragisch, süß und irre wie das Erwachsenwerden selbst ist. Neben Robert Eggers (







