Super 8, USA 2011 • 112 Min • Regie & Drehbuch: J.J. Abrams • Mit: Joel Courtney, Elle Fanning, Kyle Chandler, Zach Mills, Ron Eldard, Noah Emmerich, Gabriel Basso, Riley Griffiths, Ryan Lee • Kamera: Larry Fong • Musik: Michael Giacchino • FSK: ab 12 Jahren • Verleih: Paramount Pictures • Kinostart: 04.08.2011
 Nostalgie ist etwas, das selbst so manchem tollwütigen Kritiker die Zähne zu ziehen vermag. Es gibt halt diese kleinen Dinge im Leben, an die man sich mit Vorliebe zurückerinnert – das erste große Abenteuer, das man auf der großen Leinwand erlebt hat, zum Beispiel. Und dann gibt es andere Dinge, die es irgendwie vermögen, eben dieses vergangene Gefühl noch einmal im Hier und Jetzt aufflammen zu lassen. Vielleicht nur kurz, für die Dauer eines Spielfilms. Der Verfasser dieser Zeilen hat sein erstes großes Kinoerlebnis im Alter von zwölf Jahren erfahren, als er sich bei Steven Spielbergs „Jurassic Park“ (1993) ein verblüffend überzeugendes Bild davon machen konnte, wie sich die Dinosaurier ihren Weg aus der Urzeit in die Gegenwart bahnen. J.J. Abrams' „Super 8“ ist nun genau solch ein Film, der sofort selige Erinnerungen an die fantastischen Geschichten des zuvor genannten Hollywood-Titans (der hier obendrein recht prominent unter seinem Amblin-Banner als Produzent in Erscheinung tritt) ins Gedächtnis zurückruft, aber dennoch inszenatorisch klar die Handschrift seines Regisseurs (und „Lost“-Ko-Entwicklers) erkennen lässt. Genau genommen könnte man „Super 8“ inhaltlich sogar fast als ein Spielberg-Best-Of bezeichnen, das Elemente aus Werken wie „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ (1977), „E.T. – Der Außerirdische“ (1982), „Die Goonies“ (1985) oder eben „Jurassic Park“ zu einem neuen, schmackhaften Blockbuster umformt. Hier liegt nun auch – das gleich vorweg – der einzige, bestimmt nicht von der Hand zu weisende, Kritikpunkt des Films: „Super 8“ erfindet das Rad ganz einfach nicht neu. Nicht wenige Zuschauer, die nun möglicherweise das bahnbrechende Monster-Movie dieser Zeit erwarten, werden sich obendrein von der nicht sonderlich innovativen „Auflösung“ des Mysteriums enttäuscht zeigen. Dabei ist das Ende an sich völlig stimmig. Aufgrund der schwindelerregenden Erwartungen ist es bei den Betreffenden nur ganz einfach schon im Vorfeld zum Scheitern verurteilt gewesen.
Nostalgie ist etwas, das selbst so manchem tollwütigen Kritiker die Zähne zu ziehen vermag. Es gibt halt diese kleinen Dinge im Leben, an die man sich mit Vorliebe zurückerinnert – das erste große Abenteuer, das man auf der großen Leinwand erlebt hat, zum Beispiel. Und dann gibt es andere Dinge, die es irgendwie vermögen, eben dieses vergangene Gefühl noch einmal im Hier und Jetzt aufflammen zu lassen. Vielleicht nur kurz, für die Dauer eines Spielfilms. Der Verfasser dieser Zeilen hat sein erstes großes Kinoerlebnis im Alter von zwölf Jahren erfahren, als er sich bei Steven Spielbergs „Jurassic Park“ (1993) ein verblüffend überzeugendes Bild davon machen konnte, wie sich die Dinosaurier ihren Weg aus der Urzeit in die Gegenwart bahnen. J.J. Abrams' „Super 8“ ist nun genau solch ein Film, der sofort selige Erinnerungen an die fantastischen Geschichten des zuvor genannten Hollywood-Titans (der hier obendrein recht prominent unter seinem Amblin-Banner als Produzent in Erscheinung tritt) ins Gedächtnis zurückruft, aber dennoch inszenatorisch klar die Handschrift seines Regisseurs (und „Lost“-Ko-Entwicklers) erkennen lässt. Genau genommen könnte man „Super 8“ inhaltlich sogar fast als ein Spielberg-Best-Of bezeichnen, das Elemente aus Werken wie „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ (1977), „E.T. – Der Außerirdische“ (1982), „Die Goonies“ (1985) oder eben „Jurassic Park“ zu einem neuen, schmackhaften Blockbuster umformt. Hier liegt nun auch – das gleich vorweg – der einzige, bestimmt nicht von der Hand zu weisende, Kritikpunkt des Films: „Super 8“ erfindet das Rad ganz einfach nicht neu. Nicht wenige Zuschauer, die nun möglicherweise das bahnbrechende Monster-Movie dieser Zeit erwarten, werden sich obendrein von der nicht sonderlich innovativen „Auflösung“ des Mysteriums enttäuscht zeigen. Dabei ist das Ende an sich völlig stimmig. Aufgrund der schwindelerregenden Erwartungen ist es bei den Betreffenden nur ganz einfach schon im Vorfeld zum Scheitern verurteilt gewesen.
 Im Mittelpunkt der Geschichte steht hier auch gar nicht unbedingt das obligatorische Ungeheuer, sondern die titelgebende Super 8-Kamera (die Handlung ist in den späten Siebzigern angesiedelt, als auf diesem populären Format bevorzugt Privatfilme produziert worden sind). Abrams' Film ist zunächst eine Liebeserklärung an die Magie der bewegten Bilder und die Abenteuer, die man mit ihnen erleben kann. In einer der stärksten Szenen von „Super 8“ erklärt der junge Joe Lamb (Joel Courtney) seiner Freundin Alice Dainard (Elle Fanning), welche Bedeutung eine kurze Filmszene seiner verstorbenen Mutter für ihn hat: Während dieser Spielzeit erwacht sie für ihn wieder zum Leben, verewigt in diesen knappen Minuten. Joe, der noch immer mit dem schweren Verlust kämpft und seitdem allein von seinem Vater Jackson (Kyle Chandler), dem Deputy der verschlafenen Kleinstadt, mit strenger Hand erzogen wird, unterstützt unerlaubt als Make Up-Künstler seinen Schulfreund Charles (Riley Griffiths) bei der Erstellung seines Zombie-Kurzfilms, welcher auf einem Nachwuchswettbewerb aufgeführt werden soll. Neben weiteren Freunden, wie dem Jung-Pyromanen Cary (Ryan Lee) und dem Hauptdarsteller Martin (Gabriel Basso), gehört nach einer spontanen Drehbuchänderung nun auch Alice zur offiziellen Besetzung. Bei nächtlichen Aufnahmen am örtlichen Bahnhof werden die Kinder Zeugen eines unglaublichen Ereignisses: Während ein Güterzug der Army vorbeizieht, rast ein zunächst unbekanntes Auto auf die Schienen und verursacht einen gewaltigen Crash, welcher der Filmcrew fast Kopf und Kragen gekostet hätte. Als sie schließlich die Unfallstelle erkunden, finden sie den noch lebenden Fahrer des Wagens vor – es ist ihr Biologielehrer Dr. Woodward (Glynn Turman), der sie noch mit wirren Worten zur absoluten Geheimhaltung ermahnt, bevor ein Trupp Soldaten eintrifft und die Freunde aufgeregt flüchten. Der Vorfall zieht bald weitere, unheimliche Schatten nach sich. Zuerst verschwinden sämtliche Hunde aus der Stadt. Dann elektronische Gegenstände. Und schließlich werden auch die ersten Einwohner als vermisst gemeldet. Auch ein Metallwürfel, den Joe bei dem Wrack gefunden hat, entwickelt ein mysteriöses Eigenleben. Was geht in dem kleinen Ort vor? Nachdem selbst das Militär vorgerückt ist und die Gegend zur Sperrzone erklärt hat, wollen sowohl die Kinder, wie auch Joes Vater, der Wahrheit hinter der Geheimniskrämerei auf den Grund gehen und begeben sich dabei in höchste Lebensgefahr…
Im Mittelpunkt der Geschichte steht hier auch gar nicht unbedingt das obligatorische Ungeheuer, sondern die titelgebende Super 8-Kamera (die Handlung ist in den späten Siebzigern angesiedelt, als auf diesem populären Format bevorzugt Privatfilme produziert worden sind). Abrams' Film ist zunächst eine Liebeserklärung an die Magie der bewegten Bilder und die Abenteuer, die man mit ihnen erleben kann. In einer der stärksten Szenen von „Super 8“ erklärt der junge Joe Lamb (Joel Courtney) seiner Freundin Alice Dainard (Elle Fanning), welche Bedeutung eine kurze Filmszene seiner verstorbenen Mutter für ihn hat: Während dieser Spielzeit erwacht sie für ihn wieder zum Leben, verewigt in diesen knappen Minuten. Joe, der noch immer mit dem schweren Verlust kämpft und seitdem allein von seinem Vater Jackson (Kyle Chandler), dem Deputy der verschlafenen Kleinstadt, mit strenger Hand erzogen wird, unterstützt unerlaubt als Make Up-Künstler seinen Schulfreund Charles (Riley Griffiths) bei der Erstellung seines Zombie-Kurzfilms, welcher auf einem Nachwuchswettbewerb aufgeführt werden soll. Neben weiteren Freunden, wie dem Jung-Pyromanen Cary (Ryan Lee) und dem Hauptdarsteller Martin (Gabriel Basso), gehört nach einer spontanen Drehbuchänderung nun auch Alice zur offiziellen Besetzung. Bei nächtlichen Aufnahmen am örtlichen Bahnhof werden die Kinder Zeugen eines unglaublichen Ereignisses: Während ein Güterzug der Army vorbeizieht, rast ein zunächst unbekanntes Auto auf die Schienen und verursacht einen gewaltigen Crash, welcher der Filmcrew fast Kopf und Kragen gekostet hätte. Als sie schließlich die Unfallstelle erkunden, finden sie den noch lebenden Fahrer des Wagens vor – es ist ihr Biologielehrer Dr. Woodward (Glynn Turman), der sie noch mit wirren Worten zur absoluten Geheimhaltung ermahnt, bevor ein Trupp Soldaten eintrifft und die Freunde aufgeregt flüchten. Der Vorfall zieht bald weitere, unheimliche Schatten nach sich. Zuerst verschwinden sämtliche Hunde aus der Stadt. Dann elektronische Gegenstände. Und schließlich werden auch die ersten Einwohner als vermisst gemeldet. Auch ein Metallwürfel, den Joe bei dem Wrack gefunden hat, entwickelt ein mysteriöses Eigenleben. Was geht in dem kleinen Ort vor? Nachdem selbst das Militär vorgerückt ist und die Gegend zur Sperrzone erklärt hat, wollen sowohl die Kinder, wie auch Joes Vater, der Wahrheit hinter der Geheimniskrämerei auf den Grund gehen und begeben sich dabei in höchste Lebensgefahr…
 Mehr Informationen über J.J. Abrams' Mystery-Abenteuer preiszugeben würde bedeuten, noch so manchen fantasievollen Einfall unnötig vorwegzunehmen. Da das keineswegs im Sinne der Macher sein kann, wird sich auch der Rezensent auf seine bisherigen Angaben beschränken. Wie bereits zuvor erwähnt, bezieht „Super 8“ seine Kraft in erster Linie aus einer authentischen Liebe zum Kino selbst. Abgesehen von den unzähligen Spielberg- und Horrorfilm-Zitaten, die der Regisseur des großartigen „Star Trek“-Reboots an allen Ecken und Enden einbaut (Charles' Zimmer wird von „Halloween“- und „Dawn Of The Dead“-Postern geziert), sind es vor allem die durch die Bank sympathischen (und glücklicherweise niemals nervigen) Kindercharaktere, die bei den Zuschauern Erinnerungen an den eigenen Erstkontakt mit der Materie hervorrufen. Das Werk ist angenehm ironisch, ohne dabei je den tragischen Aspekt der Geschichte zu überspielen. Ohne bitteren Zynismus, aber dafür mit willkommen kindlicher Naivität, inspiriert es junge Kinogänger, doch auch einfach mal selbst eine Kamera in die Hand zu nehmen und die eigenen Träume einzufangen.
Mehr Informationen über J.J. Abrams' Mystery-Abenteuer preiszugeben würde bedeuten, noch so manchen fantasievollen Einfall unnötig vorwegzunehmen. Da das keineswegs im Sinne der Macher sein kann, wird sich auch der Rezensent auf seine bisherigen Angaben beschränken. Wie bereits zuvor erwähnt, bezieht „Super 8“ seine Kraft in erster Linie aus einer authentischen Liebe zum Kino selbst. Abgesehen von den unzähligen Spielberg- und Horrorfilm-Zitaten, die der Regisseur des großartigen „Star Trek“-Reboots an allen Ecken und Enden einbaut (Charles' Zimmer wird von „Halloween“- und „Dawn Of The Dead“-Postern geziert), sind es vor allem die durch die Bank sympathischen (und glücklicherweise niemals nervigen) Kindercharaktere, die bei den Zuschauern Erinnerungen an den eigenen Erstkontakt mit der Materie hervorrufen. Das Werk ist angenehm ironisch, ohne dabei je den tragischen Aspekt der Geschichte zu überspielen. Ohne bitteren Zynismus, aber dafür mit willkommen kindlicher Naivität, inspiriert es junge Kinogänger, doch auch einfach mal selbst eine Kamera in die Hand zu nehmen und die eigenen Träume einzufangen.
 Vieles davon, was eine tolle Kinoerfahrung auszeichnet, kann man in „Super 8“ erleben: Ein rührendes Familiendrama, eine Geschichte über Freundschaft und die erste große Liebe, ein rätselhaftes Abenteuer. Und natürlich auch einen sanften Horrorplot mit einem umherwütenden Monster. Stets untermalt von den gefühlvollen Klängen von Abrams' Hofkomponisten und Oscarpreisträger Michael Giacchino („Oben“) und von Kameramann Larry Fong in grandiosen Bildern eingefangen (Anhänger von Abrams' Vorliebe für lens flare-Effekte müssen auf dieses Trademark auch hier keineswegs gänzlich verzichten), serviert der Regisseur seinem Publikum ein Werk, das emotional auf unterschiedlichen Ebenen punkten kann, das sowohl spannend und gruselig, wie auch melancholisch und über weite Strecken einfach zum Brüllen komisch ist. Die große Kraft liegt hier in der dennoch homogenen Verküpfung dieser verschiedenen Gefühle. „Super 8“ ist zumindest ein Film, für den der Rezensent auch gerne ein zweites Mal eine Eintrittskarte löst. Ein Leinwand-Spektakel, das nach all der puren, ohrenbetäubenden Zerstörungswut durch irgendwelche „Transformers“ endlich mal wieder Platz für die ruhigen Momente im Auge des Sturms und seine Figuren findet – eben wie in den seligen frühen Achtzigern. Und solange es in Hollywood Träumer wie J.J. Abrams gibt, kann ein Michael Bay mit seinen Effekteskapaden allein das gute Event-Kino noch nicht vollständig in die Luft jagen.
Vieles davon, was eine tolle Kinoerfahrung auszeichnet, kann man in „Super 8“ erleben: Ein rührendes Familiendrama, eine Geschichte über Freundschaft und die erste große Liebe, ein rätselhaftes Abenteuer. Und natürlich auch einen sanften Horrorplot mit einem umherwütenden Monster. Stets untermalt von den gefühlvollen Klängen von Abrams' Hofkomponisten und Oscarpreisträger Michael Giacchino („Oben“) und von Kameramann Larry Fong in grandiosen Bildern eingefangen (Anhänger von Abrams' Vorliebe für lens flare-Effekte müssen auf dieses Trademark auch hier keineswegs gänzlich verzichten), serviert der Regisseur seinem Publikum ein Werk, das emotional auf unterschiedlichen Ebenen punkten kann, das sowohl spannend und gruselig, wie auch melancholisch und über weite Strecken einfach zum Brüllen komisch ist. Die große Kraft liegt hier in der dennoch homogenen Verküpfung dieser verschiedenen Gefühle. „Super 8“ ist zumindest ein Film, für den der Rezensent auch gerne ein zweites Mal eine Eintrittskarte löst. Ein Leinwand-Spektakel, das nach all der puren, ohrenbetäubenden Zerstörungswut durch irgendwelche „Transformers“ endlich mal wieder Platz für die ruhigen Momente im Auge des Sturms und seine Figuren findet – eben wie in den seligen frühen Achtzigern. Und solange es in Hollywood Träumer wie J.J. Abrams gibt, kann ein Michael Bay mit seinen Effekteskapaden allein das gute Event-Kino noch nicht vollständig in die Luft jagen.
Kurze Anmerkung zum Schluss: Auf keinen Fall den Saal bereits zu Beginn des Abspanns verlassen! Da bekommen einige Zuschauer ihre reine Horrorstory noch nachgeliefert…
Kritik im Original erschienen bei mannbeisstfilm.de
Trailer



 Dolphin ist ein Vampir, da ist sich Seth sicher. Und da wir „The Reflecting Skin“, das beachtliche Spielfilmdebüt des Briten Philip Ridley, aus der Sicht des Kindes betrachten, glauben wir ihm – oder schließen diese Möglichkeit zumindest nicht kategorisch aus. Seth lebt zusammen mit seiner psychotischen Mutter Ruth (Sheila Moore) und seinem in sich gekehrten Vater Luke (Duncan Fraser) irgendwo im ländlichen Nirgendwo der USA. Irgendwann in den Fünfzigern. Da sein älterer Bruder Cameron (Viggo Mortensen) in den Koreakrieg gezogen ist, fällt das herrische Wesen der Mutter nun brutal über den Übriggebliebenen her – den Vater hat sie längst mundtot gemacht, so dass sich dieser nun auf der Veranda in Schundromane über Vampire vertieft. Dem aufgeweckten Jungen ist die anfangs erwähnte Nachbarin, welche er vornehmlich mit seinen Freunden Eben (Codie Lucas Wilbee) und Kim (Evan Hall) auf grausame Weise ärgert, nicht geheuer, und als ihm sein Vater schließlich die Definition eines Blutsaugers schildert, entsteht für Seth ein unheimlicher Verdacht: „Die sind nicht sehr freundlich. Die beißen in deinen Hals und trinken dein Blut. Wenn sie das nicht tun, sind sie alt und wenn sie es tun, sind sie jung. Die armen Menschen, deren Blut sie trinken, werden ganz schnell alt und dann sind sie tot.“ Als Seth die einsame Dolphin nun tatsächlich aufgrund eines besonders bösen Streiches besuchen muss, um sich bei ihr zu entschuldigen, liefert sie ihm weitere Gründe für seine Annahme, einen Vampir vor sich zu haben. Ohne ihren verstorbenen Mann werde sie immer älter, zweihundert Jahre habe sie bereits auf dem Buckel – und sie hasst das Sonnenlicht! Die Augen des Kindes funkeln und durchdringen die Fassade der Frau, blicken tiefer als ihre Worte. Kurz darauf findet Seth seinen Freund Eben ermordet im Brunnen auf, woraufhin Luke, der in der Umgebung als Perverser gilt, verdächtigt wird und sich anschließend an der eigenen Tankstelle in Brand steckt. Cameron kehrt aus dem Krieg zurück, doch die ungetrübte Freude des Jungen darüber bleibt nur von kurzer Dauer: Sein Bruder verliebt sich ausgerechnet in die blutsaugende Dolphin…
Dolphin ist ein Vampir, da ist sich Seth sicher. Und da wir „The Reflecting Skin“, das beachtliche Spielfilmdebüt des Briten Philip Ridley, aus der Sicht des Kindes betrachten, glauben wir ihm – oder schließen diese Möglichkeit zumindest nicht kategorisch aus. Seth lebt zusammen mit seiner psychotischen Mutter Ruth (Sheila Moore) und seinem in sich gekehrten Vater Luke (Duncan Fraser) irgendwo im ländlichen Nirgendwo der USA. Irgendwann in den Fünfzigern. Da sein älterer Bruder Cameron (Viggo Mortensen) in den Koreakrieg gezogen ist, fällt das herrische Wesen der Mutter nun brutal über den Übriggebliebenen her – den Vater hat sie längst mundtot gemacht, so dass sich dieser nun auf der Veranda in Schundromane über Vampire vertieft. Dem aufgeweckten Jungen ist die anfangs erwähnte Nachbarin, welche er vornehmlich mit seinen Freunden Eben (Codie Lucas Wilbee) und Kim (Evan Hall) auf grausame Weise ärgert, nicht geheuer, und als ihm sein Vater schließlich die Definition eines Blutsaugers schildert, entsteht für Seth ein unheimlicher Verdacht: „Die sind nicht sehr freundlich. Die beißen in deinen Hals und trinken dein Blut. Wenn sie das nicht tun, sind sie alt und wenn sie es tun, sind sie jung. Die armen Menschen, deren Blut sie trinken, werden ganz schnell alt und dann sind sie tot.“ Als Seth die einsame Dolphin nun tatsächlich aufgrund eines besonders bösen Streiches besuchen muss, um sich bei ihr zu entschuldigen, liefert sie ihm weitere Gründe für seine Annahme, einen Vampir vor sich zu haben. Ohne ihren verstorbenen Mann werde sie immer älter, zweihundert Jahre habe sie bereits auf dem Buckel – und sie hasst das Sonnenlicht! Die Augen des Kindes funkeln und durchdringen die Fassade der Frau, blicken tiefer als ihre Worte. Kurz darauf findet Seth seinen Freund Eben ermordet im Brunnen auf, woraufhin Luke, der in der Umgebung als Perverser gilt, verdächtigt wird und sich anschließend an der eigenen Tankstelle in Brand steckt. Cameron kehrt aus dem Krieg zurück, doch die ungetrübte Freude des Jungen darüber bleibt nur von kurzer Dauer: Sein Bruder verliebt sich ausgerechnet in die blutsaugende Dolphin… „The Reflecting Skin“, der auch den ausnahmsweise gar nicht so unpassenden, deutschen Titel „Schrei in der Stille“ trägt, ist ein Werk, das eigentlich den Verstand eines Kindes fordert, um es wirklich ergründen zu können. Die für uns Erwachsene so konkreten Dinge verändern ihre Proportionen und Sinnhaftigkeit, wenn sie erstmal durch die kindliche Fantasiemaschine gelaufen sind – und werden für unseren rationalen Verstand nicht mehr recht greifbar. Es ist das Porträt des jungen Seth, der unter teils verstörenden Verhältnissen in einer isolierten Umgebung aufwachsen muss. Und es ist gleichzeitig ein Horrorfilm über das Sterben der Unschuld. Alles, was Seth hört oder sieht, saugt er mit riesigem Interesse, fast wie ein Schwamm, auf. „Wenn deine Ma über dich weint, tötest du einen Engel“, behauptet Kim, als die Freunde eines Tages zusammenhocken. Nach der Ermordung Ebens finden Seth und Kim einen eingewickelten Fötus in einer Scheune und die Beiden glauben nun, dass es sich dabei um dessen Umwandlung in einen Engel handele – die Kausalität von Kindern. Die beunruhigenden Vorfälle – der mysteriöse Mord, der Tod seines Vaters und die Geheimnisse um dessen Vergangenheit sowie die Verführung seines Bruders durch das Geschöpf der Nacht – rütteln an der kleinen Welt, die sich der Junge in seinem Kopf errichtet hat. Nur Cameron, der versprochen hat, sich nun um ihn zu kümmern, gibt ihm noch den nötigen Halt in der Realität. Seth kann es nicht ertragen, ihn an seinen großen Erzfeind – Dolphin – zu verlieren, weshalb er wohl alles daran setzen würde, sie aus seinem Blickfeld zu schaffen. Er weiss, wer Eben – und wenig später Kim – ermordet hat, doch versperrt er sich selbst vor der nüchternen Wahrheit, um weiterhin die Schuld dem Vampir anzulasten. Nach Camerons Entscheidung für Dolphin spricht er sich nun in der Nacht bei seinem aufgefundenen „Engel“ aus. Seinem imaginären Freund.
„The Reflecting Skin“, der auch den ausnahmsweise gar nicht so unpassenden, deutschen Titel „Schrei in der Stille“ trägt, ist ein Werk, das eigentlich den Verstand eines Kindes fordert, um es wirklich ergründen zu können. Die für uns Erwachsene so konkreten Dinge verändern ihre Proportionen und Sinnhaftigkeit, wenn sie erstmal durch die kindliche Fantasiemaschine gelaufen sind – und werden für unseren rationalen Verstand nicht mehr recht greifbar. Es ist das Porträt des jungen Seth, der unter teils verstörenden Verhältnissen in einer isolierten Umgebung aufwachsen muss. Und es ist gleichzeitig ein Horrorfilm über das Sterben der Unschuld. Alles, was Seth hört oder sieht, saugt er mit riesigem Interesse, fast wie ein Schwamm, auf. „Wenn deine Ma über dich weint, tötest du einen Engel“, behauptet Kim, als die Freunde eines Tages zusammenhocken. Nach der Ermordung Ebens finden Seth und Kim einen eingewickelten Fötus in einer Scheune und die Beiden glauben nun, dass es sich dabei um dessen Umwandlung in einen Engel handele – die Kausalität von Kindern. Die beunruhigenden Vorfälle – der mysteriöse Mord, der Tod seines Vaters und die Geheimnisse um dessen Vergangenheit sowie die Verführung seines Bruders durch das Geschöpf der Nacht – rütteln an der kleinen Welt, die sich der Junge in seinem Kopf errichtet hat. Nur Cameron, der versprochen hat, sich nun um ihn zu kümmern, gibt ihm noch den nötigen Halt in der Realität. Seth kann es nicht ertragen, ihn an seinen großen Erzfeind – Dolphin – zu verlieren, weshalb er wohl alles daran setzen würde, sie aus seinem Blickfeld zu schaffen. Er weiss, wer Eben – und wenig später Kim – ermordet hat, doch versperrt er sich selbst vor der nüchternen Wahrheit, um weiterhin die Schuld dem Vampir anzulasten. Nach Camerons Entscheidung für Dolphin spricht er sich nun in der Nacht bei seinem aufgefundenen „Engel“ aus. Seinem imaginären Freund. Der Filmtitel „The Reflecting Skin“ bezieht sich primär auf ein Foto, welches Cameron aus dem Krieg mitgebracht hat und ein nach den Explosionen silbern überzogenes Baby zeigt. Wie erwartet, erweckt auch dieses sofort Seths Interesse – die Reflektion findet also nicht nur darauf abgebildet statt. Alle Menschen und Gegenstände haben für Seth selbst den Effekt einer spiegelnden Oberfläche. Ridleys Werk, welches sich teilweise übrigens offensichtlich beim grotesken Humor eines David Lynch bedient (man beachte hier zum Beispiel die schräge Darstellung des örtlichen Sheriffs), ist mit Sicherheit kein solches, welches man Zuschauern mit einem eher konventionellen Filmgeschmack empfehlen könnte. Hier ist ein Einfühlungsvermögen in die eigenwillige und symbolische Bildsprache des Regisseurs nötig, das man wahrlich nicht jedem Kinogänger abverlangen kann. „The Reflecting Skin“ liefert seine Interpretation eben nicht gerade selbst mit, so dass man angehalten ist, zwischen den oftmals überwältigenden Landschaftsaufnahmen und den stillen Gesten des aufmerksamen Seth selbst mitzulesen, mitzudenken und mitzufühlen. Wer dazu bereit ist, wird mit einer visuell betörend schönen, aber inhaltlich nicht gerade angenehmen Reise an das Ende einer Kindheit belohnt. Die letzte Szene zeigt einen ungehörten Todesschrei.
Der Filmtitel „The Reflecting Skin“ bezieht sich primär auf ein Foto, welches Cameron aus dem Krieg mitgebracht hat und ein nach den Explosionen silbern überzogenes Baby zeigt. Wie erwartet, erweckt auch dieses sofort Seths Interesse – die Reflektion findet also nicht nur darauf abgebildet statt. Alle Menschen und Gegenstände haben für Seth selbst den Effekt einer spiegelnden Oberfläche. Ridleys Werk, welches sich teilweise übrigens offensichtlich beim grotesken Humor eines David Lynch bedient (man beachte hier zum Beispiel die schräge Darstellung des örtlichen Sheriffs), ist mit Sicherheit kein solches, welches man Zuschauern mit einem eher konventionellen Filmgeschmack empfehlen könnte. Hier ist ein Einfühlungsvermögen in die eigenwillige und symbolische Bildsprache des Regisseurs nötig, das man wahrlich nicht jedem Kinogänger abverlangen kann. „The Reflecting Skin“ liefert seine Interpretation eben nicht gerade selbst mit, so dass man angehalten ist, zwischen den oftmals überwältigenden Landschaftsaufnahmen und den stillen Gesten des aufmerksamen Seth selbst mitzulesen, mitzudenken und mitzufühlen. Wer dazu bereit ist, wird mit einer visuell betörend schönen, aber inhaltlich nicht gerade angenehmen Reise an das Ende einer Kindheit belohnt. Die letzte Szene zeigt einen ungehörten Todesschrei.
 „X-Men: Erste Entscheidung“ ist ein Film, der uns gleichzeitig etwas über die menschliche Evolution und historische Ereignisse lehren möchte und uns noch obendrein die wichtige Botschaft zu vermitteln versucht, dass es doch gar nicht so schlimm ist, individuell und irgendwie anders zu sein. Gleich drei fromme Wünsche auf einmal? Und das in 132 Minuten? Das geht nun wirklich nicht! Natürlich basiert das Werk zunächst auf den gleichnamigen Comichelden aus dem Marvel-Universum, welche ja bekanntlich schon drei erfolgreiche Kinoabenteuer gemeinsam absolviert haben und nun von Regisseur Matthew Vaughn ihre Herkunftsgeschichte spendiert bekommen. Die ersten beiden Teile der Reihe, welche von Bryan Singer („Die üblichen Verdächtigen“) inszeniert worden sind, gehören für nicht wenige Fans zu den besten Adaptionen einer Comicvorlage. Warum das so ist? Nicht den Rezensenten fragen, der hat dafür auch keine plausible Erklärung parat. (Eigentlich hat ja eh Ang Lee die bisher einzige, wirklich sehenswerte Umsetzung einer Marvel-Figur betreut…) Nun aber schnell zurück zur „Ersten Entscheidung“, deren Schöpfer unmittelbar zuvor mit „Shit-Ass“…Pardon, „Kick-Ass“ (2010) einen Kinderfilm abgeliefert hat, der nach Meinung der hiesigen Jugendschutzbeauftragten gar nicht für Kinder geeignet ist.
„X-Men: Erste Entscheidung“ ist ein Film, der uns gleichzeitig etwas über die menschliche Evolution und historische Ereignisse lehren möchte und uns noch obendrein die wichtige Botschaft zu vermitteln versucht, dass es doch gar nicht so schlimm ist, individuell und irgendwie anders zu sein. Gleich drei fromme Wünsche auf einmal? Und das in 132 Minuten? Das geht nun wirklich nicht! Natürlich basiert das Werk zunächst auf den gleichnamigen Comichelden aus dem Marvel-Universum, welche ja bekanntlich schon drei erfolgreiche Kinoabenteuer gemeinsam absolviert haben und nun von Regisseur Matthew Vaughn ihre Herkunftsgeschichte spendiert bekommen. Die ersten beiden Teile der Reihe, welche von Bryan Singer („Die üblichen Verdächtigen“) inszeniert worden sind, gehören für nicht wenige Fans zu den besten Adaptionen einer Comicvorlage. Warum das so ist? Nicht den Rezensenten fragen, der hat dafür auch keine plausible Erklärung parat. (Eigentlich hat ja eh Ang Lee die bisher einzige, wirklich sehenswerte Umsetzung einer Marvel-Figur betreut…) Nun aber schnell zurück zur „Ersten Entscheidung“, deren Schöpfer unmittelbar zuvor mit „Shit-Ass“…Pardon, „Kick-Ass“ (2010) einen Kinderfilm abgeliefert hat, der nach Meinung der hiesigen Jugendschutzbeauftragten gar nicht für Kinder geeignet ist. Da hier, wie bereits angeführt, die Ursprünge der ganz schön begabten Männlein und Weiblein ergründet werden soll, dürfen zunächst anstelle von Patrick Stewart und Ian McKellen diesmal die deutlich jüngeren Hüpfer James McAvoy („Der letzte König von Schottland“) und Michael Fassbender („Inglourious Basterds“) in die Rollen der mutierten Freundfeinde Charles Xavier/Professor X und Erik Lehnsherr/Magneto schlüpfen. So weit, so gut. Vaughn lässt zu Beginn dann auch nicht allzu viel Zeit mit der Einführung seiner beiden Hauptfiguren verstreichen, aber erzählt zur Sicherheit doch noch einmal das, was Fans ja eh schon wissen: Lehnsherr wird als Kind durch die Nazis von seinen Eltern getrennt und demonstriert in einer nahezu identischen Szene, wie sie zuvor auch Singer schon gezeigt hat, seinen Peinigern eine Kostprobe seiner magnetischen Kräfte. Daraufhin wird er von dem sinistren Naziarzt Klaus Schmidt (Kevin Bacon bemüht sich erfolglos, möglichst fies und durchgeknallt zu wirken), der sich dann im Verlauf der Handlung, die in den frühen Sechzigern angesiedelt ist, Sebastian Shaw nennt, für seine Experimente missbraucht und schwört blutige Rache. Auch Charles Xavier findet bereits im Kindesalter, wie parallel eingefügte Momente verdeutlichen, heraus, dass er offensichtlich telepathisch begabt ist und freundet sich außerdem mit der Gestaltwechslerin Raven an, die als Erwachsene von Jennifer Lawrence verkörpert wird, welche dem Rezensenten zuvor durch ihre großartige Performance in dem Drama „Winter’s Bone“ fast Tränen in die Augen getrieben hat und nun ihr Talent für eine blasse Rolle wie diese verpulvert. Da der Regisseur noch Großes vorhat und seine späteren X-Men sogar tapfer in die Kuba-Krise eingreifen lässt, muss der Verfasser dieser Zeilen – wie der Film selbst auch – das Gaspedal ordentlich durchtreten, um seinen Text irgendwann zu einem Ende zu bringen. Es sei übrigens bereits vorweggenommen, dass die extreme Hast in der Story dem Werk so gar nicht gut tut…
Da hier, wie bereits angeführt, die Ursprünge der ganz schön begabten Männlein und Weiblein ergründet werden soll, dürfen zunächst anstelle von Patrick Stewart und Ian McKellen diesmal die deutlich jüngeren Hüpfer James McAvoy („Der letzte König von Schottland“) und Michael Fassbender („Inglourious Basterds“) in die Rollen der mutierten Freundfeinde Charles Xavier/Professor X und Erik Lehnsherr/Magneto schlüpfen. So weit, so gut. Vaughn lässt zu Beginn dann auch nicht allzu viel Zeit mit der Einführung seiner beiden Hauptfiguren verstreichen, aber erzählt zur Sicherheit doch noch einmal das, was Fans ja eh schon wissen: Lehnsherr wird als Kind durch die Nazis von seinen Eltern getrennt und demonstriert in einer nahezu identischen Szene, wie sie zuvor auch Singer schon gezeigt hat, seinen Peinigern eine Kostprobe seiner magnetischen Kräfte. Daraufhin wird er von dem sinistren Naziarzt Klaus Schmidt (Kevin Bacon bemüht sich erfolglos, möglichst fies und durchgeknallt zu wirken), der sich dann im Verlauf der Handlung, die in den frühen Sechzigern angesiedelt ist, Sebastian Shaw nennt, für seine Experimente missbraucht und schwört blutige Rache. Auch Charles Xavier findet bereits im Kindesalter, wie parallel eingefügte Momente verdeutlichen, heraus, dass er offensichtlich telepathisch begabt ist und freundet sich außerdem mit der Gestaltwechslerin Raven an, die als Erwachsene von Jennifer Lawrence verkörpert wird, welche dem Rezensenten zuvor durch ihre großartige Performance in dem Drama „Winter’s Bone“ fast Tränen in die Augen getrieben hat und nun ihr Talent für eine blasse Rolle wie diese verpulvert. Da der Regisseur noch Großes vorhat und seine späteren X-Men sogar tapfer in die Kuba-Krise eingreifen lässt, muss der Verfasser dieser Zeilen – wie der Film selbst auch – das Gaspedal ordentlich durchtreten, um seinen Text irgendwann zu einem Ende zu bringen. Es sei übrigens bereits vorweggenommen, dass die extreme Hast in der Story dem Werk so gar nicht gut tut… Irgendwie gerät also Xavier, der sich inzwischen einen Namen in „Genetik“ gemacht hat, an die CIA-Agentin Moira MacTaggert (Rose Byrne, „Insidious“). Diese ist einer kommunistischen Verschwörung rund um Sebastian Shaw, der inzwischen selbst allerhand farbenfrohe Kollegen um sich gescharrt hat, auf der Spur und stellt anschließend über fünf Ecken mit Xavier gar ein CIA-Mutanten-Team zusammen, in welchem sich neben Raven und dem auf Rache sinnenden Lehnsherr noch andere Individuen befinden: Der eine hat zum Beispiel grosse Füße und kann flitzen wie die Vampire in den „Twilight“-Streifen, einer sieht aus wie Justin Bieber und spielt gern mit Feuer und noch einer kann schreien wie der kleine Oskar Matzerath aus Günter Grass' „Die Blechtrommel“. So, jetzt aber wirklich Warp 4 und weiter im Text (Apropos: Wer sich von „X-Men: Erste Entscheidung“ übrigens eine ähnlich gelungene Frischzellenkur wie vom 2009er „Star Trek“ erwartet hat, wird schwer enttäuscht – allein die ersten fünfzehn Minuten von J.J. Abrams' Neuauflage waren besser und emotionaler als dieser gesamte Film). Die Mutanten versammeln sich, feiern ordentlich ab und werden schließlich durch eine Auseinandersetzung mit Kevin Bacon, aka Shaw, in zwei Lager gespalten. Die „Guten“ nehmen den Kampf auf und starten sportlich mit ihrem Jet in Richtung Kuba, wo es bald heiß hergeht. Raketen fliegen durch die Luft und Kevin Bacon mutiert zur Atombombe, wie wir von einem besorgten Protagonisten erfahren. Fassbender kümmert sich darum, doch dann geht wirklich alles schief: Fassbender knurrt und will jetzt richtig Stress machen, während McAvoy mit der Zunge schnalzt. Der Rest der Geschichte ist ja wieder bekannt…
Irgendwie gerät also Xavier, der sich inzwischen einen Namen in „Genetik“ gemacht hat, an die CIA-Agentin Moira MacTaggert (Rose Byrne, „Insidious“). Diese ist einer kommunistischen Verschwörung rund um Sebastian Shaw, der inzwischen selbst allerhand farbenfrohe Kollegen um sich gescharrt hat, auf der Spur und stellt anschließend über fünf Ecken mit Xavier gar ein CIA-Mutanten-Team zusammen, in welchem sich neben Raven und dem auf Rache sinnenden Lehnsherr noch andere Individuen befinden: Der eine hat zum Beispiel grosse Füße und kann flitzen wie die Vampire in den „Twilight“-Streifen, einer sieht aus wie Justin Bieber und spielt gern mit Feuer und noch einer kann schreien wie der kleine Oskar Matzerath aus Günter Grass' „Die Blechtrommel“. So, jetzt aber wirklich Warp 4 und weiter im Text (Apropos: Wer sich von „X-Men: Erste Entscheidung“ übrigens eine ähnlich gelungene Frischzellenkur wie vom 2009er „Star Trek“ erwartet hat, wird schwer enttäuscht – allein die ersten fünfzehn Minuten von J.J. Abrams' Neuauflage waren besser und emotionaler als dieser gesamte Film). Die Mutanten versammeln sich, feiern ordentlich ab und werden schließlich durch eine Auseinandersetzung mit Kevin Bacon, aka Shaw, in zwei Lager gespalten. Die „Guten“ nehmen den Kampf auf und starten sportlich mit ihrem Jet in Richtung Kuba, wo es bald heiß hergeht. Raketen fliegen durch die Luft und Kevin Bacon mutiert zur Atombombe, wie wir von einem besorgten Protagonisten erfahren. Fassbender kümmert sich darum, doch dann geht wirklich alles schief: Fassbender knurrt und will jetzt richtig Stress machen, während McAvoy mit der Zunge schnalzt. Der Rest der Geschichte ist ja wieder bekannt… Die beiden besten Performances in dem Werk stammen übrigens von Hugh Jackman, der ein Cameo als Wolverine gibt und in einer Bar Fassbender und McAvoy mit den Worten „Los, verpisst euch wieder!“ anschnauzt (kann man verstehen – wer will schon bei seinem Bier von solchen Vögeln belästigt werden…), und Michael Ironside als Kriegsschiff-Captain. Letzterem nimmt man seine Rolle selbstverständlich in jeder Sekunde ab – wenn jemand der Captain sein kann, dann Ironside. Zu Sicherheit trägt er aber dennoch einen Helm, auf dem nochmal der Rang schriftlich fixiert ist. Der Film-Dienst lobt, dass der Streifen „[den] historische[n] Hintergrund geschickt [nutzt], um über die verheerende Eigenschaft von Feindbildern und Vorurteilen zu reflektieren.“ (12/2011, Seite 40) Dazu muss gesagt werden, dass sich der Bezug zur Historie in etwa auf eine Einblendung mit der Bemerkung Kuba und eine Masse an Kriegsschiffen beschränkt, die unbeirrt aufeinander zusteuern. Im schulischen Geschichtsunterricht wird „X-Men: Erste Entscheidung“ vermutlich so schnell nicht als bedeutendes Dokument auf dem Lehrplan stehen. Auch das Evolutionsthema kann bestenfalls noch Mittelstufler faszinieren, die mit der Materie noch nicht andernweitig in Berührung gekommen sind. Und zur alten Leier, um die X-Men als ein Bild für die von der Gesellschaft Ausgestossenen – nun ja…
Die beiden besten Performances in dem Werk stammen übrigens von Hugh Jackman, der ein Cameo als Wolverine gibt und in einer Bar Fassbender und McAvoy mit den Worten „Los, verpisst euch wieder!“ anschnauzt (kann man verstehen – wer will schon bei seinem Bier von solchen Vögeln belästigt werden…), und Michael Ironside als Kriegsschiff-Captain. Letzterem nimmt man seine Rolle selbstverständlich in jeder Sekunde ab – wenn jemand der Captain sein kann, dann Ironside. Zu Sicherheit trägt er aber dennoch einen Helm, auf dem nochmal der Rang schriftlich fixiert ist. Der Film-Dienst lobt, dass der Streifen „[den] historische[n] Hintergrund geschickt [nutzt], um über die verheerende Eigenschaft von Feindbildern und Vorurteilen zu reflektieren.“ (12/2011, Seite 40) Dazu muss gesagt werden, dass sich der Bezug zur Historie in etwa auf eine Einblendung mit der Bemerkung Kuba und eine Masse an Kriegsschiffen beschränkt, die unbeirrt aufeinander zusteuern. Im schulischen Geschichtsunterricht wird „X-Men: Erste Entscheidung“ vermutlich so schnell nicht als bedeutendes Dokument auf dem Lehrplan stehen. Auch das Evolutionsthema kann bestenfalls noch Mittelstufler faszinieren, die mit der Materie noch nicht andernweitig in Berührung gekommen sind. Und zur alten Leier, um die X-Men als ein Bild für die von der Gesellschaft Ausgestossenen – nun ja…
 Jüngere Kinogänger werden mit dem Namen John Carpenter vermutlich wenig bis gar nichts mehr anfangen können. „Ach ja, ich glaube, das ist dieser Typ, der den ersten von diesen langweiligen 'Halloween'-Streifen gedreht hat?!“, wird ihnen vielleicht noch als abfälliger Kommentar über einen der (wenn nicht sogar den) spannendsten und einflussreichsten Regisseure der Siebziger und Achtziger über die Lippen kommen. Leider lässt sich tatsächlich festhalten, dass es in den vergangenen Jahren verdächtig still um die 63-jährige Filmikone geworden ist. Sein letzter, reichlich zerfahrener, Spielfilm „Ghosts Of Mars“ liegt inzwischen stolze zehn Jahre zurück und lediglich zwei Kurzeinträge in die Masters Of Horror-Reihe (der gelungene „Cigarette Burns“ sowie der ungleich schwächere „Pro-Life“) haben die Hoffnung der Fans auf ein späteres Leinwand-Comeback des Meisters aufrecht erhalten. „The Ward“ nennt sich nun schließlich Carpenters Rückkehr ins Kino-Rampenlicht – ein Werk, das der Regisseur auf dem letztjährigen TIFF per charismatischer Videobotschaft als „old school horror movie by an old school director“ seinem Publikum vorgestellt hat.
Jüngere Kinogänger werden mit dem Namen John Carpenter vermutlich wenig bis gar nichts mehr anfangen können. „Ach ja, ich glaube, das ist dieser Typ, der den ersten von diesen langweiligen 'Halloween'-Streifen gedreht hat?!“, wird ihnen vielleicht noch als abfälliger Kommentar über einen der (wenn nicht sogar den) spannendsten und einflussreichsten Regisseure der Siebziger und Achtziger über die Lippen kommen. Leider lässt sich tatsächlich festhalten, dass es in den vergangenen Jahren verdächtig still um die 63-jährige Filmikone geworden ist. Sein letzter, reichlich zerfahrener, Spielfilm „Ghosts Of Mars“ liegt inzwischen stolze zehn Jahre zurück und lediglich zwei Kurzeinträge in die Masters Of Horror-Reihe (der gelungene „Cigarette Burns“ sowie der ungleich schwächere „Pro-Life“) haben die Hoffnung der Fans auf ein späteres Leinwand-Comeback des Meisters aufrecht erhalten. „The Ward“ nennt sich nun schließlich Carpenters Rückkehr ins Kino-Rampenlicht – ein Werk, das der Regisseur auf dem letztjährigen TIFF per charismatischer Videobotschaft als „old school horror movie by an old school director“ seinem Publikum vorgestellt hat. Mit einer atmosphärischen Eingangssequenz werden zunächst wohlige Erinnerungen an die Anfangstage der Legende geweckt: Die subjektive Kamera überquert zu den unheilvollen Geräuschen schwerer Schritte den finsteren Korridor einer psychiatrischen Klinik. Vor einem Zimmer, neben welchem der Name Tammy an einer Tafel angeschlagen steht, macht sie Halt und blickt durch ein Fenster auf die sich darin befindliche, völlig verängstigte Patientin herab. Hände ergreifen aus dem Hinterhalt den Hals der jungen Frau und brechen ihr das Genick. Der riesige weisse Schriftzug „John Carpenter’s The Ward“ leitet anschließend einen elegant umgesetzten Vorspann ein, während welchem historische Bilder von der Behandlung „Irrer“ in Zeitlupe zu Scherben zerbrechen. Fans wird hier schon auffallen, dass der Regisseur ausnahmsweise mal nicht zusätzlich einen markanten Soundtrack beigesteuert hat, sondern diesen Posten Mark Kilian („Machtlos“) überließ, welcher jedoch – das als Entwarnung – ganze Arbeit mit seinen verträumten Klängen leistet. Wie man dann durch eine Einblendung erfährt, ist die folgende Geschichte im Jahre 1966 angesiedelt. Die junge Kristen (Amber Heard, „All the Boys love Mandy Lane“) wird von der Polizei vor einem Farmhaus aufgegriffen, welches sie zuvor in Brand gesteckt hat. Sie schlägt um sich, wehrt sich gegen ihre Verhaftung – und wird schließlich in jene Klinik eingewiesen, in welcher sich der zuvor beschriebene Mord ereignet hat…
Mit einer atmosphärischen Eingangssequenz werden zunächst wohlige Erinnerungen an die Anfangstage der Legende geweckt: Die subjektive Kamera überquert zu den unheilvollen Geräuschen schwerer Schritte den finsteren Korridor einer psychiatrischen Klinik. Vor einem Zimmer, neben welchem der Name Tammy an einer Tafel angeschlagen steht, macht sie Halt und blickt durch ein Fenster auf die sich darin befindliche, völlig verängstigte Patientin herab. Hände ergreifen aus dem Hinterhalt den Hals der jungen Frau und brechen ihr das Genick. Der riesige weisse Schriftzug „John Carpenter’s The Ward“ leitet anschließend einen elegant umgesetzten Vorspann ein, während welchem historische Bilder von der Behandlung „Irrer“ in Zeitlupe zu Scherben zerbrechen. Fans wird hier schon auffallen, dass der Regisseur ausnahmsweise mal nicht zusätzlich einen markanten Soundtrack beigesteuert hat, sondern diesen Posten Mark Kilian („Machtlos“) überließ, welcher jedoch – das als Entwarnung – ganze Arbeit mit seinen verträumten Klängen leistet. Wie man dann durch eine Einblendung erfährt, ist die folgende Geschichte im Jahre 1966 angesiedelt. Die junge Kristen (Amber Heard, „All the Boys love Mandy Lane“) wird von der Polizei vor einem Farmhaus aufgegriffen, welches sie zuvor in Brand gesteckt hat. Sie schlägt um sich, wehrt sich gegen ihre Verhaftung – und wird schließlich in jene Klinik eingewiesen, in welcher sich der zuvor beschriebene Mord ereignet hat… Leider muss der Rezensent – welcher sich selbst seit seiner Kindheit als grosser John Carpenter-Fan bezeichnet – zugeben, dass sich „The Ward“ nach seinem soliden Start als allzu austauschbarer Horrorthriller entpuppt, der zudem das sonst so sichere Gespür des Regisseurs für eine subtile Bedrohung weitgehend außen vor lässt und dieses gegen laute und teils blutrünstige Schockeffekte eingetauscht hat. Eigentlich ist bereits zu Beginn klar, in welche Richtung die Reise gehen wird: Da ist die unter Amnesie leidende Hauptfigur Kristen, ein nerviges Grüppchen weiterer Patientinnen, das sinistre Klinikpersonal und ein mordender Unhold, um den sich ein internes Geheimnis rankt – eine solche Personenkonstellation sieht man im Genrekino bestimmt nicht zum ersten Mal, und wer mal an die letzten ähnlich gestrickten Storys zurückdenkt, wird nicht nur relativ treffsicher voraussagen können, hinter welcher Ecke sich der nächste Schreck versteckt, sondern sich sogar von der finalen „Auflösung“ eher angeödet als überrascht zeigen.
Leider muss der Rezensent – welcher sich selbst seit seiner Kindheit als grosser John Carpenter-Fan bezeichnet – zugeben, dass sich „The Ward“ nach seinem soliden Start als allzu austauschbarer Horrorthriller entpuppt, der zudem das sonst so sichere Gespür des Regisseurs für eine subtile Bedrohung weitgehend außen vor lässt und dieses gegen laute und teils blutrünstige Schockeffekte eingetauscht hat. Eigentlich ist bereits zu Beginn klar, in welche Richtung die Reise gehen wird: Da ist die unter Amnesie leidende Hauptfigur Kristen, ein nerviges Grüppchen weiterer Patientinnen, das sinistre Klinikpersonal und ein mordender Unhold, um den sich ein internes Geheimnis rankt – eine solche Personenkonstellation sieht man im Genrekino bestimmt nicht zum ersten Mal, und wer mal an die letzten ähnlich gestrickten Storys zurückdenkt, wird nicht nur relativ treffsicher voraussagen können, hinter welcher Ecke sich der nächste Schreck versteckt, sondern sich sogar von der finalen „Auflösung“ eher angeödet als überrascht zeigen. „The Ward“ fehlt es neben einem interessanteren Grundkonzept außerdem an sympathischen oder zumindest kantigen Charakteren. Kristen weist zwar durchaus einen Carpenter-typischen, rebellischen Dickkopf auf, allerdings erschöpft sich dieser hier in einer zickigen Aufmüpfigkeit gegen die Pfleger und Schwestern der Einrichtung. Die übrigen Figuren sind dann so blass und schablonenhaft gezeichnet, dass man sie in dem Werk kaum als Individuen wahrnehmen kann und sie eher als ein schwammiges Gebilde potentieller Opfer vor sich sieht. Als größtes Problem des Films stellt sich jedoch der obligatorische Bösewicht heraus: Abgesehen vom erwähnten Anfang existiert in „The Ward“ kein wirklicher Moment, in welchem dieser echte Angst oder Nervenkitzel beim Zuschauer auslöst. Meist kündigt ein lautes Getöse dessen Auftritt spektakulärer an, als sich das Ergebnis letztlich darstellt – ein Sturm im Wasserglas. Diese uninteressante Geistergestalt steht zumindest in keinem Vergleich zu den vielen, durch ihre mysteriöse Aura gerade effektiven, Unholden aus früheren Werken des Regisseurs. Ein unheimlicher Mythos, wie er bei Michael Myers, den auf Rache sinnenden Seeleuten oder gar dem Vampirfürsten Valek präsent war, fehlt hinter diesem Wesen völlig. Auch wenn „The Ward“ recht stimmungsvoll in dem von John Carpenter stets favorisierten Cinemascope-Format eingefangen worden ist, erweist sich das meiste, was über die puren Bilder hinausgeht, als enttäuschend müde Fingerübung für den ursprünglichen Spannungs-Garanten. Wie auf Autopilot spult der Meister nun die alte Story von der Flucht aus der unheimlichen Anstalt ab und kann (oder mag) dieser nicht den erhofften Glanz echter Inspiration verleihen. Wer das Thema gern wirklich packend und modern aufbereitet sehen möchte, sollte zumindest lieber zu Brad Andersons „Session 9“ (2001) greifen…
„The Ward“ fehlt es neben einem interessanteren Grundkonzept außerdem an sympathischen oder zumindest kantigen Charakteren. Kristen weist zwar durchaus einen Carpenter-typischen, rebellischen Dickkopf auf, allerdings erschöpft sich dieser hier in einer zickigen Aufmüpfigkeit gegen die Pfleger und Schwestern der Einrichtung. Die übrigen Figuren sind dann so blass und schablonenhaft gezeichnet, dass man sie in dem Werk kaum als Individuen wahrnehmen kann und sie eher als ein schwammiges Gebilde potentieller Opfer vor sich sieht. Als größtes Problem des Films stellt sich jedoch der obligatorische Bösewicht heraus: Abgesehen vom erwähnten Anfang existiert in „The Ward“ kein wirklicher Moment, in welchem dieser echte Angst oder Nervenkitzel beim Zuschauer auslöst. Meist kündigt ein lautes Getöse dessen Auftritt spektakulärer an, als sich das Ergebnis letztlich darstellt – ein Sturm im Wasserglas. Diese uninteressante Geistergestalt steht zumindest in keinem Vergleich zu den vielen, durch ihre mysteriöse Aura gerade effektiven, Unholden aus früheren Werken des Regisseurs. Ein unheimlicher Mythos, wie er bei Michael Myers, den auf Rache sinnenden Seeleuten oder gar dem Vampirfürsten Valek präsent war, fehlt hinter diesem Wesen völlig. Auch wenn „The Ward“ recht stimmungsvoll in dem von John Carpenter stets favorisierten Cinemascope-Format eingefangen worden ist, erweist sich das meiste, was über die puren Bilder hinausgeht, als enttäuschend müde Fingerübung für den ursprünglichen Spannungs-Garanten. Wie auf Autopilot spult der Meister nun die alte Story von der Flucht aus der unheimlichen Anstalt ab und kann (oder mag) dieser nicht den erhofften Glanz echter Inspiration verleihen. Wer das Thema gern wirklich packend und modern aufbereitet sehen möchte, sollte zumindest lieber zu Brad Andersons „Session 9“ (2001) greifen…
 „This is an old fashion creepy chiller“ – mit diesen vielversprechenden Worten hat „Saw“-Schöpfer James Wan seine neueste Arbeit „Insidious“, welche er erneut in Zusammenarbeit mit seinem Freund und Drehbuchautor Leigh Whannell realisiert hat, bei der letztjährigen Premiere auf dem Toronto International Film Festival angekündigt. Und Recht soll der Regisseur mit seiner Beschreibung behalten: Das Werk, welches mit einem schleichend-bedrohlichen Tempo beginnt, verweist in seiner ersten Hälfte recht offensichtlich auf solche Klassiker wie William Friedkins „Der Exorzist“ (1973) oder Tobe Hoopers „Poltergeist“ (1982) und dürfte vor allem Horrorfreunde begeistern, die die gepflegte Gänsehaut dem exzessiven Blutbad vorziehen. Unglücklich mit dem Ergebnis ihrer Universal Pictures-Kollaboration – dem trotz aller kreativer Differenzen sehr stimmungsvoll umgesetzten Gruselfilm „Dead Silence“ (2007) -, hat sich das Regie/Autoren-Duo diesmal das Ziel gesetzt, dem Publikum seinen definitiven Beitrag zum Genre zu präsentieren. Während sich viele moderne Filmemacher damit zufrieden geben, die altbekannten Zutaten stur Punkt für Punkt abzuhaken und den Zuschauern damit letztlich ein lediglich lauwarmes Süppchen vorzusetzen, weben die sich selbst auch klar als Fans bekennenden Kreativköpfe äußerst geschickt einige wahrlich abgefahrene Ideen (wer hat zuvor schon Dämonen zu dem Tiny Tim-Song „
„This is an old fashion creepy chiller“ – mit diesen vielversprechenden Worten hat „Saw“-Schöpfer James Wan seine neueste Arbeit „Insidious“, welche er erneut in Zusammenarbeit mit seinem Freund und Drehbuchautor Leigh Whannell realisiert hat, bei der letztjährigen Premiere auf dem Toronto International Film Festival angekündigt. Und Recht soll der Regisseur mit seiner Beschreibung behalten: Das Werk, welches mit einem schleichend-bedrohlichen Tempo beginnt, verweist in seiner ersten Hälfte recht offensichtlich auf solche Klassiker wie William Friedkins „Der Exorzist“ (1973) oder Tobe Hoopers „Poltergeist“ (1982) und dürfte vor allem Horrorfreunde begeistern, die die gepflegte Gänsehaut dem exzessiven Blutbad vorziehen. Unglücklich mit dem Ergebnis ihrer Universal Pictures-Kollaboration – dem trotz aller kreativer Differenzen sehr stimmungsvoll umgesetzten Gruselfilm „Dead Silence“ (2007) -, hat sich das Regie/Autoren-Duo diesmal das Ziel gesetzt, dem Publikum seinen definitiven Beitrag zum Genre zu präsentieren. Während sich viele moderne Filmemacher damit zufrieden geben, die altbekannten Zutaten stur Punkt für Punkt abzuhaken und den Zuschauern damit letztlich ein lediglich lauwarmes Süppchen vorzusetzen, weben die sich selbst auch klar als Fans bekennenden Kreativköpfe äußerst geschickt einige wahrlich abgefahrene Ideen (wer hat zuvor schon Dämonen zu dem Tiny Tim-Song „ Das junge Ehepaar Renai (Rose Byrne, „Sunshine“) und Josh Lambert (Patrick Wilson, „Hard Candy“) hat mit seinen drei Kindern gerade erst ein schickes Haus in einem ruhigen Vorort bezogen, als sich in diesem zunächst unscheinbare Vorfälle ereignen: Frisch einsortierte Bücher liegen plötzlich neben dem Regal…kein Grund zur Panik, diesen Unfug wird wohl bestimmt einer der kleinen Racker veranstaltet haben! Als jedoch ihr achtjähriger Sohn Dalton (Ty Simpkins hat bereits in „Little Children“ Patrick Wilsons Filmsohn verkörpert) auf dem dunklen Dachboden von einer Leiter stürzt und daraufhin in ein mysteriöses Koma fällt, bricht für die glückliche Familie nicht nur die heile Welt zusammen – auch der Spuk im Gebäude nimmt nun angsteinflössende Ausmaße an. Es scheint so, als ob das Kind ein Opfer von finsteren Mächten geworden ist, die nun auch seinen Angehörigen das blanke Grauen lehren wollen. Da selbst der kurz darauf unternommene Umzug in ein neues Anwesen die bedrohlichen Erscheinungen nicht zu verbannen vermag und auch Daltons Zustand keine Besserung zeigt, bittet das Paar in völliger Verzweiflung das Medium Elise Rainier (Lin Shaye, „Verrückt nach Mary“) und ihre beiden Assistenten (als Ghostbusters geben sich Angus Sampson und Leigh Whannell selbst die Ehre) um Hilfe. Doch deren Untersuchungsergebnisse stellen für die Lamberts keine Beruhigung dar: „Es ist nicht das Haus, das besessen ist…“
Das junge Ehepaar Renai (Rose Byrne, „Sunshine“) und Josh Lambert (Patrick Wilson, „Hard Candy“) hat mit seinen drei Kindern gerade erst ein schickes Haus in einem ruhigen Vorort bezogen, als sich in diesem zunächst unscheinbare Vorfälle ereignen: Frisch einsortierte Bücher liegen plötzlich neben dem Regal…kein Grund zur Panik, diesen Unfug wird wohl bestimmt einer der kleinen Racker veranstaltet haben! Als jedoch ihr achtjähriger Sohn Dalton (Ty Simpkins hat bereits in „Little Children“ Patrick Wilsons Filmsohn verkörpert) auf dem dunklen Dachboden von einer Leiter stürzt und daraufhin in ein mysteriöses Koma fällt, bricht für die glückliche Familie nicht nur die heile Welt zusammen – auch der Spuk im Gebäude nimmt nun angsteinflössende Ausmaße an. Es scheint so, als ob das Kind ein Opfer von finsteren Mächten geworden ist, die nun auch seinen Angehörigen das blanke Grauen lehren wollen. Da selbst der kurz darauf unternommene Umzug in ein neues Anwesen die bedrohlichen Erscheinungen nicht zu verbannen vermag und auch Daltons Zustand keine Besserung zeigt, bittet das Paar in völliger Verzweiflung das Medium Elise Rainier (Lin Shaye, „Verrückt nach Mary“) und ihre beiden Assistenten (als Ghostbusters geben sich Angus Sampson und Leigh Whannell selbst die Ehre) um Hilfe. Doch deren Untersuchungsergebnisse stellen für die Lamberts keine Beruhigung dar: „Es ist nicht das Haus, das besessen ist…“ Insidious bedeutet übersetzt heimtückisch oder hinterlistig – warum das Duo nun ausgerechnet dieses Adjektiv als Titel für seinen aktuellen Film ausgewählt hat, soll allerdings nicht bereits vorweg genommen werden. Nur so viel: Wenn man den bereits erwähnten „Poltergeist“ nehmen, der anfangs familienfreundlichen Stimmung einige deftige Terroreinlagen hinzufügen und die um zusätzliche, interessante Aspekte bereicherte Geschichte weiterspinnen würde, wäre man in etwa bei dem angelangt, was sich die Köpfe von James Wan und Leigh Whannell mit „Insidious“ ausgesponnen haben – ein moderner, hinterhälter Spukhorror für eine neue Zuschauergeneration. Möglicherweise wird sich der Aufbau des Werkes für manchen Zuschauer als ein wenig problematisch herausstellen. Nach der besuchten Pressevorführung hat ein Kritikerkollege bereits angemerkt, dass ihm der ruhige Anfang des Films gut gefallen habe, während die deutlich effektlastigere, zweite Hälfte für ihn nicht recht funktionierte. Diese Ansicht teilt der Rezensent nachdrücklich nicht. Zugegebenermaßen baut der Regisseur zu Beginn eine sehr dichte Atmosphäre auf, die im Vergleich zum furiosen weiteren Verlauf eher auf subtilen Grusel setzt – allerdings dient der Einstieg auch eher einer Einladung zu einer finsteren Reise in eine unbekannte Ferne. Voraussetzung ist natürlich, man lässt sich auf das dort präsentierte Reich dann auch wirklich ein…
Insidious bedeutet übersetzt heimtückisch oder hinterlistig – warum das Duo nun ausgerechnet dieses Adjektiv als Titel für seinen aktuellen Film ausgewählt hat, soll allerdings nicht bereits vorweg genommen werden. Nur so viel: Wenn man den bereits erwähnten „Poltergeist“ nehmen, der anfangs familienfreundlichen Stimmung einige deftige Terroreinlagen hinzufügen und die um zusätzliche, interessante Aspekte bereicherte Geschichte weiterspinnen würde, wäre man in etwa bei dem angelangt, was sich die Köpfe von James Wan und Leigh Whannell mit „Insidious“ ausgesponnen haben – ein moderner, hinterhälter Spukhorror für eine neue Zuschauergeneration. Möglicherweise wird sich der Aufbau des Werkes für manchen Zuschauer als ein wenig problematisch herausstellen. Nach der besuchten Pressevorführung hat ein Kritikerkollege bereits angemerkt, dass ihm der ruhige Anfang des Films gut gefallen habe, während die deutlich effektlastigere, zweite Hälfte für ihn nicht recht funktionierte. Diese Ansicht teilt der Rezensent nachdrücklich nicht. Zugegebenermaßen baut der Regisseur zu Beginn eine sehr dichte Atmosphäre auf, die im Vergleich zum furiosen weiteren Verlauf eher auf subtilen Grusel setzt – allerdings dient der Einstieg auch eher einer Einladung zu einer finsteren Reise in eine unbekannte Ferne. Voraussetzung ist natürlich, man lässt sich auf das dort präsentierte Reich dann auch wirklich ein…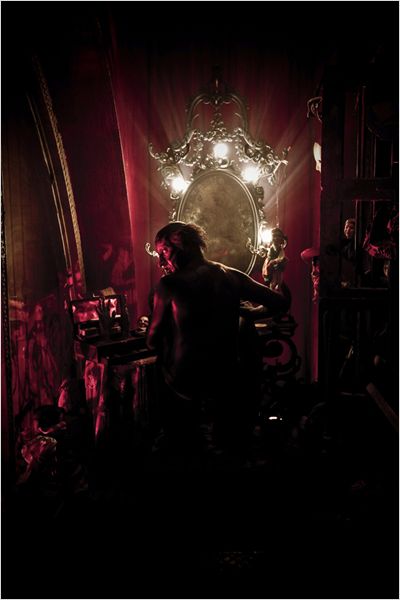 „Insidious“ besitzt neben glaubhaften Figuren (die für eine solch kleine Genreproduktion ungewöhnlich von durchaus prominenten Gesichtern verkörpert werden) zudem etwas, das im aktuellen Fantastischen Kino leider oftmals zu kurz kommt: Er verwurzelt seine Story in einer eigenen Mythologie, in deren Kontext sich auch das abschließende Drittel, das neben David Lynchs Albtraumbildern auch deutlich Wes Cravens „Nightmare – Mörderische Träume“ (1984) zitiert, unmittelbar und homogen mit dem vorherigen Part zusammenfügt. Wie bereits erwähnt, haben sich die Verantwortlichen bewusst dafür entschieden, das Werk im Rahmen einer Low Budget-Produktion fertig zu stellen. Ein Beschluss, der sich tatsächlich extrem positiv auf das Gänsehaut-erzeugende und streckenweise auch recht humorvolle Resultat niedergeschlagen hat. Der Film wirkt völlig ungezwungen, kommt löblicherweise ohne unnötigen CGI-Schnickschnack aus und man merkt diesem förmlich zu jeder Sekunde an, dass hier Fans mit einer echten Leidenschaft für das Genre ans Werk gegangen sind – die irrwitzigen Einfälle sprudeln geradezu aus diesem hervor. Ein wenig hat man als Zuschauer ein Gefühl, wie wenn man nach dem Martinssingen einen bunten Sack prall mit Süßigkeiten in der Hand hält, aus welchem einem vielleicht nicht jeder Schokoriegel gleich gut schmeckt, aber man letztlich dennoch hochzufrieden mit der Gesamtausbeute ist. Ähnlich wie Sam Raimis „Drag Me to Hell“ (2009) ist „Insidious“ ein Film, der rund 100 Minuten Spaß und Schrecken garantiert, aber dabei ganz sicher keinen intellektuellen Anspruch erhebt. Darauf sollte man sich einstellen, wenn man eine Karte für die wilde Geisterbahnfahrt löst. James Wan und Leigh Whannell ist es hier definitiv gelungen, den Horror der Siebziger und frühen Achtziger auf sympathische Weise zu würdigen und diesem zugleich frischen (oder besser: eiskalten) Atem einzuhauchen. „Insidious“ ist eine willkommen fantasievolle Bereicherung für ein langsam in Kunstblut und Splatter zu ertrinken drohendes Genre.
„Insidious“ besitzt neben glaubhaften Figuren (die für eine solch kleine Genreproduktion ungewöhnlich von durchaus prominenten Gesichtern verkörpert werden) zudem etwas, das im aktuellen Fantastischen Kino leider oftmals zu kurz kommt: Er verwurzelt seine Story in einer eigenen Mythologie, in deren Kontext sich auch das abschließende Drittel, das neben David Lynchs Albtraumbildern auch deutlich Wes Cravens „Nightmare – Mörderische Träume“ (1984) zitiert, unmittelbar und homogen mit dem vorherigen Part zusammenfügt. Wie bereits erwähnt, haben sich die Verantwortlichen bewusst dafür entschieden, das Werk im Rahmen einer Low Budget-Produktion fertig zu stellen. Ein Beschluss, der sich tatsächlich extrem positiv auf das Gänsehaut-erzeugende und streckenweise auch recht humorvolle Resultat niedergeschlagen hat. Der Film wirkt völlig ungezwungen, kommt löblicherweise ohne unnötigen CGI-Schnickschnack aus und man merkt diesem förmlich zu jeder Sekunde an, dass hier Fans mit einer echten Leidenschaft für das Genre ans Werk gegangen sind – die irrwitzigen Einfälle sprudeln geradezu aus diesem hervor. Ein wenig hat man als Zuschauer ein Gefühl, wie wenn man nach dem Martinssingen einen bunten Sack prall mit Süßigkeiten in der Hand hält, aus welchem einem vielleicht nicht jeder Schokoriegel gleich gut schmeckt, aber man letztlich dennoch hochzufrieden mit der Gesamtausbeute ist. Ähnlich wie Sam Raimis „Drag Me to Hell“ (2009) ist „Insidious“ ein Film, der rund 100 Minuten Spaß und Schrecken garantiert, aber dabei ganz sicher keinen intellektuellen Anspruch erhebt. Darauf sollte man sich einstellen, wenn man eine Karte für die wilde Geisterbahnfahrt löst. James Wan und Leigh Whannell ist es hier definitiv gelungen, den Horror der Siebziger und frühen Achtziger auf sympathische Weise zu würdigen und diesem zugleich frischen (oder besser: eiskalten) Atem einzuhauchen. „Insidious“ ist eine willkommen fantasievolle Bereicherung für ein langsam in Kunstblut und Splatter zu ertrinken drohendes Genre.
 Schmerzhafte Wahrheit – und zwar mehr als nur ein kleines Stückchen – steckt in den knapp zwei Stunden Spielzeit von „Blue Valentine“, dem zweiten Spielfilm von Derek Cianfrance („Brother Tied“). Es ist ein Werk, das sich nicht scheut, das Unangenehme in Bilder und Worte zu verpacken. Aber vor allem eines, das den Zuschauern tief unter die Haut kriecht und so schnell nicht wieder verschwinden will. Filme über Beziehungen gibt es in der weiten Kinolandschaft so einige. Viele davon sind kitschig, manche tatsächlich romantisch – aber nur wenige trauen sich, in die schwärzesten Tiefen des Themas einzutauchen. Was ist Liebe, wo und wie beginnt sie? Könnte wirklich ein einzelner Blick der Grund für das Bündnis zweier Menschen sein? Oder basiert diese romantische Vorstellung nur auf einem Gefühl, möglicherweise einem Trugschluss? Der Möbelpacker Dean (Ryan Gosling, „Half Nelson“) sieht bei einem Auftrag in einem Altersheim die attraktive Cindy (Michelle Williams, „Brokeback Mountain“). Er stellt sich vor, startet eine kurze Konversation und übergibt ihr seine Karte. Die Ambition für seinen Annährungsversuch nahm Dean aus einem Gefühl heraus – dem Gefühl, die Frau gegenüber bereits irgendwie zu kennen. Nachdem er in sie hineingeschaut hat. Der erwartete Anruf Cindys bleibt aus, doch in einem Bus treffen sich die Beiden zufällig wieder. Dean lässt während einer nächtlichen Gesangseinlage seinen Charme spielen und sein Funke springt endlich auf seine Angebetete über. Der unschuldige Beginn endet ungeplant in Cindys Schwangerschaft und die frisch Verliebten beschließen zu heiraten…
Schmerzhafte Wahrheit – und zwar mehr als nur ein kleines Stückchen – steckt in den knapp zwei Stunden Spielzeit von „Blue Valentine“, dem zweiten Spielfilm von Derek Cianfrance („Brother Tied“). Es ist ein Werk, das sich nicht scheut, das Unangenehme in Bilder und Worte zu verpacken. Aber vor allem eines, das den Zuschauern tief unter die Haut kriecht und so schnell nicht wieder verschwinden will. Filme über Beziehungen gibt es in der weiten Kinolandschaft so einige. Viele davon sind kitschig, manche tatsächlich romantisch – aber nur wenige trauen sich, in die schwärzesten Tiefen des Themas einzutauchen. Was ist Liebe, wo und wie beginnt sie? Könnte wirklich ein einzelner Blick der Grund für das Bündnis zweier Menschen sein? Oder basiert diese romantische Vorstellung nur auf einem Gefühl, möglicherweise einem Trugschluss? Der Möbelpacker Dean (Ryan Gosling, „Half Nelson“) sieht bei einem Auftrag in einem Altersheim die attraktive Cindy (Michelle Williams, „Brokeback Mountain“). Er stellt sich vor, startet eine kurze Konversation und übergibt ihr seine Karte. Die Ambition für seinen Annährungsversuch nahm Dean aus einem Gefühl heraus – dem Gefühl, die Frau gegenüber bereits irgendwie zu kennen. Nachdem er in sie hineingeschaut hat. Der erwartete Anruf Cindys bleibt aus, doch in einem Bus treffen sich die Beiden zufällig wieder. Dean lässt während einer nächtlichen Gesangseinlage seinen Charme spielen und sein Funke springt endlich auf seine Angebetete über. Der unschuldige Beginn endet ungeplant in Cindys Schwangerschaft und die frisch Verliebten beschließen zu heiraten… Eine Beziehung oder Ehe ist nichts, was man erlernen könnte. Sie ist wie ein Sprung ins kalte Wasser und die wichtigste Frage, die man sich zuvor wohl stellen sollte, ist, ob man sich gegenseitig vertraut. Und ob man sich selbst und seinen Gefühlen vertrauen kann. Auch Cindy stellt sich diese Frage. Sie hat in der Vergangenheit Auseinandersetzungen zwischen ihren Eltern erlebt, die sie an der Beständigkeit von Gefühlen zweifeln lassen. Dennoch geht sie das Wagnis ein und gibt ihr Ja-Wort – „in guten wie in schlechten Zeiten“. Die schlechten Zeiten kommen. Heimtückisch, schleichend. Als wäre die Liebe eine Krankheit, die ihre Träger irgendwann unerwartet in die Knie zwingt. Was zunächst romantisch und voller Leidenschaft beginnt, endet in einem kühlen, toten Nichts. Verdeutlicht wird der Kontrast zwischen dem Auf und Ab der Beziehung durch den Wechsel von Szenen von verschiedenen zeitlichen Eckpunkten. „Blue Valentine“ beginnt irgendwo am Scheitelpunkt, vielleicht auch kurz danach. Die Kälte, welche sämtliche Gefühle zu verschlingen droht, stellt Regisseur Cianfrance sinnbildlich in einer unmenschlich-sterilen, blau beleuchteten Motel-Suite, in welcher sich das Paar eigentlich erneut lieben wollte und welche Dean treffend als „Roboter-Vagina“ bezeichnet, dar. Dort tritt die traurige Wahrheit erstmals in aller Härte zu Tage und die Beiden müssen erkennen, dass das Verfallsdatum ihrer Liebe abgelaufen zu sein scheint – was bleibt ist die Fassade. Enttäuschung und Frust nehmen nun die ehemaligen Plätze von Leidenschaft und Aufopferung ein. Und das unschuldige Opfer der dysfunktionalen Ehe bleibt, wie so oft, das Kind…
Eine Beziehung oder Ehe ist nichts, was man erlernen könnte. Sie ist wie ein Sprung ins kalte Wasser und die wichtigste Frage, die man sich zuvor wohl stellen sollte, ist, ob man sich gegenseitig vertraut. Und ob man sich selbst und seinen Gefühlen vertrauen kann. Auch Cindy stellt sich diese Frage. Sie hat in der Vergangenheit Auseinandersetzungen zwischen ihren Eltern erlebt, die sie an der Beständigkeit von Gefühlen zweifeln lassen. Dennoch geht sie das Wagnis ein und gibt ihr Ja-Wort – „in guten wie in schlechten Zeiten“. Die schlechten Zeiten kommen. Heimtückisch, schleichend. Als wäre die Liebe eine Krankheit, die ihre Träger irgendwann unerwartet in die Knie zwingt. Was zunächst romantisch und voller Leidenschaft beginnt, endet in einem kühlen, toten Nichts. Verdeutlicht wird der Kontrast zwischen dem Auf und Ab der Beziehung durch den Wechsel von Szenen von verschiedenen zeitlichen Eckpunkten. „Blue Valentine“ beginnt irgendwo am Scheitelpunkt, vielleicht auch kurz danach. Die Kälte, welche sämtliche Gefühle zu verschlingen droht, stellt Regisseur Cianfrance sinnbildlich in einer unmenschlich-sterilen, blau beleuchteten Motel-Suite, in welcher sich das Paar eigentlich erneut lieben wollte und welche Dean treffend als „Roboter-Vagina“ bezeichnet, dar. Dort tritt die traurige Wahrheit erstmals in aller Härte zu Tage und die Beiden müssen erkennen, dass das Verfallsdatum ihrer Liebe abgelaufen zu sein scheint – was bleibt ist die Fassade. Enttäuschung und Frust nehmen nun die ehemaligen Plätze von Leidenschaft und Aufopferung ein. Und das unschuldige Opfer der dysfunktionalen Ehe bleibt, wie so oft, das Kind… Es ist allerdings nicht so, dass Derek Cianfrance seine Figuren als aktive Täter zeichnet oder eine besondere Schuldzuweisung vermittelt. Cindy und Dean sind zwei absolut realistisch gezeichnete, sympathische Menschen, mit denen man sich als Zuschauer hundertprozentig identifizieren kann. Gerade deshalb trifft einen das Werk dann auch dort so erbarmungslos, wo es richtig wehtut. Dieselbe Geschichte, dieselben Fehler könnten einem auch selbst begegnen – keine Frage. Vor der Macht der eigenen Gefühlswelt ist schließlich niemand gefeilt. Beide Partner kämpfen, beide verlieren. In diesem Fall ist das so. Cindy ist enttäuscht über Deans Verlust an Ehrgeiz, mit welchem er ihr vor der Ehe so sehr imponiert hat, während er sein Potential und seine Vorhaben für ein trautes Familienleben über Bord geworfen hat. Absolut sagenhaft sind in „Blue Valentine“ die schauspielerischen Leistungen ausgefallen, die auch das Herzstück der Produktion bilden. Michelle Williams hat sich mit ihrer mutigen Darstellung dann auch ihre zweite Oscar-Nominierung nach „Brokeback Mountain“ redlich verdient, während Ryan Gosling unverständlicherweise ignoriert worden ist. Nach Ansicht des Rezensenten hat der Mime nämlich nicht nur die beste männliche Performance des vergangenen Kinojahres abgeliefert, sondern stellt generell den überzeugendsten Schauspieler seiner Generation dar. Was das gerade mal eine Millionen US-Dollar teure Werk selbst angeht, so hätte man auch hier trotz starker Konkurrenz mehr Anerkennung von Seiten der Academy erwarten können – doch das ist schließlich ein anderes Thema. Zählen soll unterm Strich allein, ob sich „Blue Valentine“ als intensive Filmerfahrung bezeichnen lässt. Und das ist definitiv der Fall – mit Nachdruck. Wenn es schon sonst niemand tut, vergibt zumindest der Schreiber den Titel „Film des Jahres“ für dieses bitter-süße Independent-Meisterwerk.
Es ist allerdings nicht so, dass Derek Cianfrance seine Figuren als aktive Täter zeichnet oder eine besondere Schuldzuweisung vermittelt. Cindy und Dean sind zwei absolut realistisch gezeichnete, sympathische Menschen, mit denen man sich als Zuschauer hundertprozentig identifizieren kann. Gerade deshalb trifft einen das Werk dann auch dort so erbarmungslos, wo es richtig wehtut. Dieselbe Geschichte, dieselben Fehler könnten einem auch selbst begegnen – keine Frage. Vor der Macht der eigenen Gefühlswelt ist schließlich niemand gefeilt. Beide Partner kämpfen, beide verlieren. In diesem Fall ist das so. Cindy ist enttäuscht über Deans Verlust an Ehrgeiz, mit welchem er ihr vor der Ehe so sehr imponiert hat, während er sein Potential und seine Vorhaben für ein trautes Familienleben über Bord geworfen hat. Absolut sagenhaft sind in „Blue Valentine“ die schauspielerischen Leistungen ausgefallen, die auch das Herzstück der Produktion bilden. Michelle Williams hat sich mit ihrer mutigen Darstellung dann auch ihre zweite Oscar-Nominierung nach „Brokeback Mountain“ redlich verdient, während Ryan Gosling unverständlicherweise ignoriert worden ist. Nach Ansicht des Rezensenten hat der Mime nämlich nicht nur die beste männliche Performance des vergangenen Kinojahres abgeliefert, sondern stellt generell den überzeugendsten Schauspieler seiner Generation dar. Was das gerade mal eine Millionen US-Dollar teure Werk selbst angeht, so hätte man auch hier trotz starker Konkurrenz mehr Anerkennung von Seiten der Academy erwarten können – doch das ist schließlich ein anderes Thema. Zählen soll unterm Strich allein, ob sich „Blue Valentine“ als intensive Filmerfahrung bezeichnen lässt. Und das ist definitiv der Fall – mit Nachdruck. Wenn es schon sonst niemand tut, vergibt zumindest der Schreiber den Titel „Film des Jahres“ für dieses bitter-süße Independent-Meisterwerk.
 Gleich zu Beginn von „Black Swan“, der inzwischen fünften Spielfilm-Arbeit des renommierten Independent-Regisseurs Darren Aronofsky, werden wir in den Alltag der aufopferungsvollen aber schüchternen Ballerina, welche durchweg brillant von der völlig zu Recht für ihre Performance für den Golden Globe nominierten Natalie Portman („Hautnah“) verkörpert wird, eingeführt, welcher in erster Linie vom sowohl physisch als auch psychisch harten Training und ihrer Mutter Erica (Barbara Hershey, „Entity“) dominiert wird. Erica hat ihre eigene Ballett-Karriere für das Leben ihrer Tochter an den Nagel gehängt und opfert nun jede Minute ihrer Zeit, um Nina auf dem Weg zu dem Erfolg zu unterstützen, in dessen Genuss sie nie gekommen ist. Allerdings erscheint das Engagement der Mutter übertrieben und irgendwie unheimlich – sehr bald wird nämlich deutlich, dass Ninas rosa-rotes und mit Plüschtieren übersätes Domizil eher einer Isolationszelle für die unschuldige Prinzessin als einem gemütlichen Zuhause gleichkommt. Die perfekte Fassade Ninas beginnt letztlich zu bröckeln, als der zuständige Bühnen-Regisseur Thomas Leroy (Vincent Cassel, „Die purpurnen Flüsse“, „Irreversible“), dem der zweifelhafte Ruf eines Wolfes, der alle seine Starletts früher oder später in sein Bett zerrt, vorauseilt, sein neues Talent mit der sexuellen Natur des schwarzen Schwans konfrontiert und in der Gestalt der anziehenden Lily (Mila Kunis, „The Book Of Eli“) außerdem Ninas stärkste Konkurrentin auf der Bildfläche erscheint, welche offensichtlich all das verkörpert, was Nina für ihre Doppelrolle fehlt…
Gleich zu Beginn von „Black Swan“, der inzwischen fünften Spielfilm-Arbeit des renommierten Independent-Regisseurs Darren Aronofsky, werden wir in den Alltag der aufopferungsvollen aber schüchternen Ballerina, welche durchweg brillant von der völlig zu Recht für ihre Performance für den Golden Globe nominierten Natalie Portman („Hautnah“) verkörpert wird, eingeführt, welcher in erster Linie vom sowohl physisch als auch psychisch harten Training und ihrer Mutter Erica (Barbara Hershey, „Entity“) dominiert wird. Erica hat ihre eigene Ballett-Karriere für das Leben ihrer Tochter an den Nagel gehängt und opfert nun jede Minute ihrer Zeit, um Nina auf dem Weg zu dem Erfolg zu unterstützen, in dessen Genuss sie nie gekommen ist. Allerdings erscheint das Engagement der Mutter übertrieben und irgendwie unheimlich – sehr bald wird nämlich deutlich, dass Ninas rosa-rotes und mit Plüschtieren übersätes Domizil eher einer Isolationszelle für die unschuldige Prinzessin als einem gemütlichen Zuhause gleichkommt. Die perfekte Fassade Ninas beginnt letztlich zu bröckeln, als der zuständige Bühnen-Regisseur Thomas Leroy (Vincent Cassel, „Die purpurnen Flüsse“, „Irreversible“), dem der zweifelhafte Ruf eines Wolfes, der alle seine Starletts früher oder später in sein Bett zerrt, vorauseilt, sein neues Talent mit der sexuellen Natur des schwarzen Schwans konfrontiert und in der Gestalt der anziehenden Lily (Mila Kunis, „The Book Of Eli“) außerdem Ninas stärkste Konkurrentin auf der Bildfläche erscheint, welche offensichtlich all das verkörpert, was Nina für ihre Doppelrolle fehlt… Wie in allen Filmen Aronofskys zuvor („Pi“, „Requiem for a Dream“, „The Fountain“, „The Wrestler“), rückt der Regisseur auch in „Black Swan“ die Obsession seiner Hauptfigur in den Mittelpunkt einer Geschichte, über der man schon zu Anfang fatalistisch das schwebende Damokles-Schwert erahnt und die sich zunächst bedrohlich-langsam wie eine Spirale in einen schwarzen Abgrund bohrt. Aronofsky lässt uns sein neuestes Werk aus der Sicht Ninas erleben – zumindest liegt der Verdacht mehr als nahe, dass die Schreckensbilder, die wir ebenso wie die psychisch wenig stabile Frau vermehrt wahrnehmen, nicht etwa vom Satan höchstpersönlich entsandt worden sind, sondern ihrer eigenen Großhirnrinde entstammen. Denn selbst wenn inzwischen Genre-Fanzine „Black Swan“ gern als den nächsten großen Schocker anpreisen und durchaus Anspielungen auf frühe De Palma-Arbeiten auszumachen sind, sowie ganz offensichtlich Bezug auf Polanskis Paranoia-Studien „Ekel“ (1965) und „Der Mieter“ (1976) genommen wird: Passender lässt sich der eigenwillige aber absolut grandiose Film als ein psychologischer (meinetwegen Horror-)Thriller klassifizieren, dessen übersinnliche Elemente allerdings zur Veranschaulichung der innerlichen Metamorphose der Hauptfigur dienen. Darren Aronofsky geht dabei mit einer ähnlichen Technik wie bei seinem Drama „Requiem for a Dream“ vor – oder hat dort etwa irgendein Zuschauer ernsthaft geglaubt, dass Ellen Burstyns Charakter tatsächlich von einem menschenfressenden Kühlschrank verfolgt wird…? Eben.
Wie in allen Filmen Aronofskys zuvor („Pi“, „Requiem for a Dream“, „The Fountain“, „The Wrestler“), rückt der Regisseur auch in „Black Swan“ die Obsession seiner Hauptfigur in den Mittelpunkt einer Geschichte, über der man schon zu Anfang fatalistisch das schwebende Damokles-Schwert erahnt und die sich zunächst bedrohlich-langsam wie eine Spirale in einen schwarzen Abgrund bohrt. Aronofsky lässt uns sein neuestes Werk aus der Sicht Ninas erleben – zumindest liegt der Verdacht mehr als nahe, dass die Schreckensbilder, die wir ebenso wie die psychisch wenig stabile Frau vermehrt wahrnehmen, nicht etwa vom Satan höchstpersönlich entsandt worden sind, sondern ihrer eigenen Großhirnrinde entstammen. Denn selbst wenn inzwischen Genre-Fanzine „Black Swan“ gern als den nächsten großen Schocker anpreisen und durchaus Anspielungen auf frühe De Palma-Arbeiten auszumachen sind, sowie ganz offensichtlich Bezug auf Polanskis Paranoia-Studien „Ekel“ (1965) und „Der Mieter“ (1976) genommen wird: Passender lässt sich der eigenwillige aber absolut grandiose Film als ein psychologischer (meinetwegen Horror-)Thriller klassifizieren, dessen übersinnliche Elemente allerdings zur Veranschaulichung der innerlichen Metamorphose der Hauptfigur dienen. Darren Aronofsky geht dabei mit einer ähnlichen Technik wie bei seinem Drama „Requiem for a Dream“ vor – oder hat dort etwa irgendein Zuschauer ernsthaft geglaubt, dass Ellen Burstyns Charakter tatsächlich von einem menschenfressenden Kühlschrank verfolgt wird…? Eben. Sehr viele Parallelen weist „Black Swan“ auch zu seinem Vorgänger „The Wrestler“ auf. Bei diesem Umstand handelt es sich allerdings keineswegs um einen Zufall, denn ursprünglich sollten in der Tat die beiden Geschichten zu einem einzigen Film verwoben werden. Dieses Vorhaben ist nun letztlich zugunsten zweier Werke, die aber zusammen gesehen durchaus ein interessantes Gesamtbild ergeben, verworfen worden. Obwohl beide Filme den Aufstieg und Fall von Vertretern unterschiedlicher Kunstformen behandeln, fühlt sich „Black Swan“ stilistisch wesentlich kühler und steriler als sein Gegenpart an – die Tragik von Tschaikowskis Schwanensee findet in Aronofskys Werk vor allem hinter der Bühne statt: Die Liebe des Prinzen, die in dem Ballett-Stück den Bann des weißen Schwans brechen könnte, findet in Ninas Leben keine Entsprechung. Fraglich bleibt, ob es der von der Mutter abgeschotteten, labilen Frau überhaupt jemals möglich gewesen ist, soziale Kontakte abseits des Theaters zu knüpfen. Vermutlich nicht. Nahezu alle äußeren Einflüsse scheinen Nina zu verängstigen, vor allem die sexuellen Anspielungen ihres Regisseurs verunsichern sie und setzen unter ihrer Oberfläche eine gefährliche Lawine ins Rollen. Irgendjemand scheint sie zu verfolgen – ist es tatsächlich Lily, die auf Nina eine eigenartige Faszination ausübt, oder ist die kalte Hand in ihrem Nacken womöglich ihre eigene? Wir hören ferne Geräusche und Stimmen und werden Zeuge von bizarren Szenarien…doch existieren diese überhaupt außerhalb des Kopfes der Hauptdarstellerin? Ein merkwürdiger Ausschlag am Rücken sowie die finsteren Reflektionen ihrer selbst in Spiegeln oder anderen Menschen – wie zum Beispiel in ihrer verbitterten Vorgängerin Beth (Winona Ryder) – dienen als Vorboten ihres scheinbar unausweichlichen Schicksals: Der schwarze Schwan droht aus der Ballerina hervorzubrechen.
Sehr viele Parallelen weist „Black Swan“ auch zu seinem Vorgänger „The Wrestler“ auf. Bei diesem Umstand handelt es sich allerdings keineswegs um einen Zufall, denn ursprünglich sollten in der Tat die beiden Geschichten zu einem einzigen Film verwoben werden. Dieses Vorhaben ist nun letztlich zugunsten zweier Werke, die aber zusammen gesehen durchaus ein interessantes Gesamtbild ergeben, verworfen worden. Obwohl beide Filme den Aufstieg und Fall von Vertretern unterschiedlicher Kunstformen behandeln, fühlt sich „Black Swan“ stilistisch wesentlich kühler und steriler als sein Gegenpart an – die Tragik von Tschaikowskis Schwanensee findet in Aronofskys Werk vor allem hinter der Bühne statt: Die Liebe des Prinzen, die in dem Ballett-Stück den Bann des weißen Schwans brechen könnte, findet in Ninas Leben keine Entsprechung. Fraglich bleibt, ob es der von der Mutter abgeschotteten, labilen Frau überhaupt jemals möglich gewesen ist, soziale Kontakte abseits des Theaters zu knüpfen. Vermutlich nicht. Nahezu alle äußeren Einflüsse scheinen Nina zu verängstigen, vor allem die sexuellen Anspielungen ihres Regisseurs verunsichern sie und setzen unter ihrer Oberfläche eine gefährliche Lawine ins Rollen. Irgendjemand scheint sie zu verfolgen – ist es tatsächlich Lily, die auf Nina eine eigenartige Faszination ausübt, oder ist die kalte Hand in ihrem Nacken womöglich ihre eigene? Wir hören ferne Geräusche und Stimmen und werden Zeuge von bizarren Szenarien…doch existieren diese überhaupt außerhalb des Kopfes der Hauptdarstellerin? Ein merkwürdiger Ausschlag am Rücken sowie die finsteren Reflektionen ihrer selbst in Spiegeln oder anderen Menschen – wie zum Beispiel in ihrer verbitterten Vorgängerin Beth (Winona Ryder) – dienen als Vorboten ihres scheinbar unausweichlichen Schicksals: Der schwarze Schwan droht aus der Ballerina hervorzubrechen. „Black Swan“ beginnt zwar schleichend und elegant, aber bläst schließlich zum Aronofsky-typischen, hysterischen Crescendo, bei welchem einem Irrsinn und Genialität wie von einem Tornado aufgewirbelt um Augen und Ohren fegen.In erster Linie gehört das Werk ganz und gar seinen Hauptdarstellerinnen Portman und Kunis, die über ihre vorherigen Leistungen hinauswachsen und zweifellos Jahresbesten-Performances an den Tag legen. Matthew Libatiques flexible Kameraarbeit klebt deshalb stets nah an den Figuren und scheint manchmal gar mit der Leichtigkeit eines Ballett-Partners um diese zu tanzen. Der Bipolarität der Geschichte Rechnung tragend, steuert auch Aronofsky die Perfektion seines Films durch die technisch versierte Komposition des betörend ästhetischen bis ungezügelt wilden Bildmaterials an. Sowohl der weiße wie auch der schwarze Schwan finden inszenatorisch ihr Pendant. Ob nun die dezenten aber dennoch effektiven Horror-Elemente, der gelegentlich durchschimmernde, groteske Humor oder die schlüpfrige Einlage zwischen Natalie Portman und Mila Kunis, welche im Vorfeld bereits für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat, nicht doch zu viel des Guten für die eher konservative Academy sein könnten, bleibt noch abzuwarten.Aber Preisregen hin oder her: „Black Swan“ gehört einfach zum Faszinierendsten und Besten, was in diesem Jahr über die Leinwände geflimmert ist.
„Black Swan“ beginnt zwar schleichend und elegant, aber bläst schließlich zum Aronofsky-typischen, hysterischen Crescendo, bei welchem einem Irrsinn und Genialität wie von einem Tornado aufgewirbelt um Augen und Ohren fegen.In erster Linie gehört das Werk ganz und gar seinen Hauptdarstellerinnen Portman und Kunis, die über ihre vorherigen Leistungen hinauswachsen und zweifellos Jahresbesten-Performances an den Tag legen. Matthew Libatiques flexible Kameraarbeit klebt deshalb stets nah an den Figuren und scheint manchmal gar mit der Leichtigkeit eines Ballett-Partners um diese zu tanzen. Der Bipolarität der Geschichte Rechnung tragend, steuert auch Aronofsky die Perfektion seines Films durch die technisch versierte Komposition des betörend ästhetischen bis ungezügelt wilden Bildmaterials an. Sowohl der weiße wie auch der schwarze Schwan finden inszenatorisch ihr Pendant. Ob nun die dezenten aber dennoch effektiven Horror-Elemente, der gelegentlich durchschimmernde, groteske Humor oder die schlüpfrige Einlage zwischen Natalie Portman und Mila Kunis, welche im Vorfeld bereits für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat, nicht doch zu viel des Guten für die eher konservative Academy sein könnten, bleibt noch abzuwarten.Aber Preisregen hin oder her: „Black Swan“ gehört einfach zum Faszinierendsten und Besten, was in diesem Jahr über die Leinwände geflimmert ist.
 Ein unerfülltes Wunschprojekt von Meisterregisseur Alfred Hitchcock ist es bekanntlich gewesen, einen Film zu inszenieren, dessen gesamtes Setting sich auf eine einzelne Telefonzelle beschränkt. Diese Grundidee ist freilich weit vor der Herrschaft der Mobiltelefone entstanden. Als schließlich Joel Schumacher mit dem packenden Thriller „Nicht auflegen!“ (2002) die nun fertige Vorlage von Larry Cohen für die große Leinwand aufbereitet hat, hatte sich die weite Welt der Telekommunikation bereits arg gewandelt: Nur ein geringer Teil der Bevölkerung dieses Planeten nutzt nun noch unterwegs die altmodischen Münzfernsprecher, während die Mehrheit eher bequem schnurlos per Handy mit Freunden und Bekannten quasselt. Diese Errungenschaft ließ sich selbstverständlich nicht in dem in der Gegenwart angesiedelten Film verleugnen, weshalb das ursprünglich noch minimalistischere Konzept auch einige dramaturgische Tücken durch die technischen Fortschritte zu umgehen verstand. Vielleicht kann man nun behaupten, dass „Buried“, ein kleines aber extrem gemeines Independent-Biest vom spanischen Newcomer Rodrigo Cortés („The Contestant – Der Kandidat“, 2007), noch eher den Geist des verstorbenen Suspense-Genies atmet, als das erwähnte, vergleichsweise hippe Werk.
Ein unerfülltes Wunschprojekt von Meisterregisseur Alfred Hitchcock ist es bekanntlich gewesen, einen Film zu inszenieren, dessen gesamtes Setting sich auf eine einzelne Telefonzelle beschränkt. Diese Grundidee ist freilich weit vor der Herrschaft der Mobiltelefone entstanden. Als schließlich Joel Schumacher mit dem packenden Thriller „Nicht auflegen!“ (2002) die nun fertige Vorlage von Larry Cohen für die große Leinwand aufbereitet hat, hatte sich die weite Welt der Telekommunikation bereits arg gewandelt: Nur ein geringer Teil der Bevölkerung dieses Planeten nutzt nun noch unterwegs die altmodischen Münzfernsprecher, während die Mehrheit eher bequem schnurlos per Handy mit Freunden und Bekannten quasselt. Diese Errungenschaft ließ sich selbstverständlich nicht in dem in der Gegenwart angesiedelten Film verleugnen, weshalb das ursprünglich noch minimalistischere Konzept auch einige dramaturgische Tücken durch die technischen Fortschritte zu umgehen verstand. Vielleicht kann man nun behaupten, dass „Buried“, ein kleines aber extrem gemeines Independent-Biest vom spanischen Newcomer Rodrigo Cortés („The Contestant – Der Kandidat“, 2007), noch eher den Geist des verstorbenen Suspense-Genies atmet, als das erwähnte, vergleichsweise hippe Werk. Zwar kommt auch hier das aus der heutigen Gesellschaft kaum wegzudenkende Mobiltelefon zum Einsatz – es bleibt aber für den Protagonisten Paul Conroy (Ryan Reynolds) in einer schweißtreibend aussichtslosen Situation tatsächlich auch die einzige Kommunikations-möglichkeit mit der Außenwelt. Und was ist denn bitte ein in der glühenden Hitze vergrabener Sarg mit einem lebenden Menschen und einem Handy als Inhalt anderes als eine Telefonzelle der morbidesten Art? Nach dem Erwachen und der darauf folgenden ersten Panikattacke, beginnt Paul seine Gedanken zu sortieren und erinnert sich an den Vorfall, der ihn vermutlich in seine missliche Lage versetzt hat: Während eines Jobs als Truck-Fahrer im Irak ist sein Konvoi in einen terroristischen Hinterhalt geraten und er von den Verantwortlichen überwältigt und bewusstlos geschlagen worden. Um Hilfe zu bekommen greift der verzweifelte Mann in seinem stickigen Grab schließlich zu dem einzigen primär nützlichen Objekt, das man mit ihm in der hölzernen Kiste gelassen hat – einem Handy. Doch der Empfang ist schlecht, der Akku nur halb geladen und einige Teilnehmer am Ende der Notruf-Leitungen stellen sich als enttäuschend wenig kooperativ heraus. Außerdem läuft die Zeit davon, der Sauerstoff wird knapp und Zweifel an den Möglichkeiten seiner Rettung verätzen langsam Pauls Gehirn…
Zwar kommt auch hier das aus der heutigen Gesellschaft kaum wegzudenkende Mobiltelefon zum Einsatz – es bleibt aber für den Protagonisten Paul Conroy (Ryan Reynolds) in einer schweißtreibend aussichtslosen Situation tatsächlich auch die einzige Kommunikations-möglichkeit mit der Außenwelt. Und was ist denn bitte ein in der glühenden Hitze vergrabener Sarg mit einem lebenden Menschen und einem Handy als Inhalt anderes als eine Telefonzelle der morbidesten Art? Nach dem Erwachen und der darauf folgenden ersten Panikattacke, beginnt Paul seine Gedanken zu sortieren und erinnert sich an den Vorfall, der ihn vermutlich in seine missliche Lage versetzt hat: Während eines Jobs als Truck-Fahrer im Irak ist sein Konvoi in einen terroristischen Hinterhalt geraten und er von den Verantwortlichen überwältigt und bewusstlos geschlagen worden. Um Hilfe zu bekommen greift der verzweifelte Mann in seinem stickigen Grab schließlich zu dem einzigen primär nützlichen Objekt, das man mit ihm in der hölzernen Kiste gelassen hat – einem Handy. Doch der Empfang ist schlecht, der Akku nur halb geladen und einige Teilnehmer am Ende der Notruf-Leitungen stellen sich als enttäuschend wenig kooperativ heraus. Außerdem läuft die Zeit davon, der Sauerstoff wird knapp und Zweifel an den Möglichkeiten seiner Rettung verätzen langsam Pauls Gehirn… „Buried“ ist ein auf Zelluloid gebannter Albtraum. Ein Schauderstück, das selbst Edgar Allan Poe noch heute die ewige Ruhe rauben würde. Im Prinzip sogar ein etwas anderer Torture-Porn, der den blutrünstigen „Hostel“-Szenarien die psychischen Qualen des Protagonisten gegenüberstellt. Vor allem ist dieses Werk aber ein Experiment. Weniger in Bezug auf seine bewusst reduzierte und überschaubare Story, als vielmehr hinsichtlich seiner geradezu einmaligen Ausführung. Cortés gelingt tatsächlich das Kunststück, das Geschehen ohne Rückblenden oder andere Kompromisse lediglich auf den Klaustrophobie-erzeugenden Schauplatz zu beschränken und trotzdem die Zuschauer permanent bei der Stange zu halten. Da Pauls Charakter und die – im wahrsten Sinne des Wortes – erdrückende Atmosphäre die einzigen direkten Bezugspunkte für das Publikum darstellen, sind natürlich die Fähigkeiten von Hauptdarsteller Reynolds und die von Kameramann Eduard Grau in besonderem Maße gefordert gewesen. Während Grau der engen Todesfalle (für die Dreharbeiten sind spezielle Särge mit unterschiedlichen Maßen abgefertigt worden) durch geschickte Bildeinstellungen und dezente Tricks fast schon ein monströses Eigenleben verleiht, kann der zuvor eher auf schwache Rollen in Produktionen der Marke „Blade: Trinity“ (2004) oder „Selbst ist die Braut“ (2009) abonnierte Ryan Reynolds hier wirklich zeigen, welch großes schauspielerisches Potential doch in ihm schlummert. Man darf an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass der Mime zwangsläufig die gesamte Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zieht (die Information, ob einige der Telefon-Sprecher später noch persönlich in Erscheinung treten, würde schließlich einen großen Spoiler darstellen) und sämtliches emotionales Gewicht und Identifikationspotential allein auf seinen Schultern lastet. Auch wenn man in „Buried“ keine ausführliche Vorgeschichte präsentiert bekommt, hat man wohl selten eine solch enge Beziehung mit einer Filmfigur aufbauen können wie hier. Diese rund 90 Minuten Spielzeit gehören einfach einzig und allein Paul Conroy.
„Buried“ ist ein auf Zelluloid gebannter Albtraum. Ein Schauderstück, das selbst Edgar Allan Poe noch heute die ewige Ruhe rauben würde. Im Prinzip sogar ein etwas anderer Torture-Porn, der den blutrünstigen „Hostel“-Szenarien die psychischen Qualen des Protagonisten gegenüberstellt. Vor allem ist dieses Werk aber ein Experiment. Weniger in Bezug auf seine bewusst reduzierte und überschaubare Story, als vielmehr hinsichtlich seiner geradezu einmaligen Ausführung. Cortés gelingt tatsächlich das Kunststück, das Geschehen ohne Rückblenden oder andere Kompromisse lediglich auf den Klaustrophobie-erzeugenden Schauplatz zu beschränken und trotzdem die Zuschauer permanent bei der Stange zu halten. Da Pauls Charakter und die – im wahrsten Sinne des Wortes – erdrückende Atmosphäre die einzigen direkten Bezugspunkte für das Publikum darstellen, sind natürlich die Fähigkeiten von Hauptdarsteller Reynolds und die von Kameramann Eduard Grau in besonderem Maße gefordert gewesen. Während Grau der engen Todesfalle (für die Dreharbeiten sind spezielle Särge mit unterschiedlichen Maßen abgefertigt worden) durch geschickte Bildeinstellungen und dezente Tricks fast schon ein monströses Eigenleben verleiht, kann der zuvor eher auf schwache Rollen in Produktionen der Marke „Blade: Trinity“ (2004) oder „Selbst ist die Braut“ (2009) abonnierte Ryan Reynolds hier wirklich zeigen, welch großes schauspielerisches Potential doch in ihm schlummert. Man darf an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass der Mime zwangsläufig die gesamte Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zieht (die Information, ob einige der Telefon-Sprecher später noch persönlich in Erscheinung treten, würde schließlich einen großen Spoiler darstellen) und sämtliches emotionales Gewicht und Identifikationspotential allein auf seinen Schultern lastet. Auch wenn man in „Buried“ keine ausführliche Vorgeschichte präsentiert bekommt, hat man wohl selten eine solch enge Beziehung mit einer Filmfigur aufbauen können wie hier. Diese rund 90 Minuten Spielzeit gehören einfach einzig und allein Paul Conroy.
 So unglaublich diese Geschichte auch klingt: Inspiriert worden ist sie von den realen Taten des Serienmörders Richard Trenton Chase, der Ende der 70er Jahre in Kalifornien sechs Menschen auf eben diese Weise getötet hat und schließlich von der Polizei dingfest gemacht werden konnte. Nach seiner Festnahme offenbahrte Chase den Ermittlern paranoide Wahnvorstellungen – Nazi-Ufos, die ihn angeblich zu seinen Verbrechen angestiftet hätten und ihn vergiften würden. Um sein eigenes Blut vor einer Verpulverung zu bewahren, habe er das der Opfer trinken müssen. Vor Gericht ist er von der Jury für schuldig befunden und schließlich zum Tod in der Gaskammer verurteilt worden. Bevor es jedoch zu der Vollstreckung kam, hat Chase, der als Vampir von Sacramento bekannt wurde, in seiner Zelle mit einer Überdosis Antidepressiva Selbstmord begangen.
So unglaublich diese Geschichte auch klingt: Inspiriert worden ist sie von den realen Taten des Serienmörders Richard Trenton Chase, der Ende der 70er Jahre in Kalifornien sechs Menschen auf eben diese Weise getötet hat und schließlich von der Polizei dingfest gemacht werden konnte. Nach seiner Festnahme offenbahrte Chase den Ermittlern paranoide Wahnvorstellungen – Nazi-Ufos, die ihn angeblich zu seinen Verbrechen angestiftet hätten und ihn vergiften würden. Um sein eigenes Blut vor einer Verpulverung zu bewahren, habe er das der Opfer trinken müssen. Vor Gericht ist er von der Jury für schuldig befunden und schließlich zum Tod in der Gaskammer verurteilt worden. Bevor es jedoch zu der Vollstreckung kam, hat Chase, der als Vampir von Sacramento bekannt wurde, in seiner Zelle mit einer Überdosis Antidepressiva Selbstmord begangen. Wie bereits eingangs erwähnt, diente dessen Person als Vorlage für die Figur des Charlie Reece, dessen Geschichte der Autor William P. Wood in seinem Roman „Rampage“ verarbeitet hat, auf welchem wiederum der gleichnamige Thriller von William Friedkin basiert. Entstanden ist die Filmadaption bereits 1987. Aufgrund des Bankrotts der produzierenden „De Laurentiis Entertainment Group“ sollte es jedoch ganze fünf Jahre dauern, bis das Werk seinen Weg auf die US-amerikanischen Leinwände finden würde. Hierzulande tauchte es 1990 unter dem Titel „Anklage Massenmord“ ohne vorherigen Kinoeinsatz still und leise in den Regalen der Videotheken ab und dürfte bei den wenigsten Kunden großes Aufsehen erregt haben. Tatsächlich sind die Release-Umstände des Films mehr als bedauerlich, denn die extrem unangenehme und deprimierende Geschichte gehört nach dem Meisterwerk „Der Exorzist“ (1973) zum Intensivsten, was Regisseur Friedkin seinen Zuschauern je „zugemutet“ hat. Das liegt zum einen daran, dass er hier nicht versucht, einen Horrorfilm voll billiger Ekel-Momente zu erschaffen, sondern den provokanten Fall von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet: Von dem des Täters, denen der Opfer und dem des Staatsanwaltes Anthony Fraser. Letzterer wird von dem zuvor aus James Camerons „Terminator“ (1984) und „Aliens – Die Rückkehr“ (1986) bekannten Michael Biehn verkörpert, der in seiner Rolle als Gegner der Todesstrafe, dessen Überzeugungen durch die bestialischen Taten erschüttert werden, die wohl überzeugendste Leistung seiner Karriere abgeliefert hat. Auch Alex McArthur, der dem unheimlichen Charlie Reece sein Gesicht leiht, beeindruckt durch eine undurchsichtige Performance, die dem Publikum bis zum Schluss die Entscheidung schwer macht, ob sich unter dessen ruhiger Hülle ein schwer kranker Psychopath oder ein eiskalt berechnender Killer verbirgt. Um allerdings zunächst überhaupt einen emotionalen Berührungspunkt zu der Geschichte zu schaffen, führt Friedkin auch die Trauer des Familienvaters Gene Tippetts (Royce D. Applegate) vor Augen, der zusammen mit seinem jungen Sohn Andrew (Whit Hertford) die verstümmelte Leiche seiner Frau findet. Die Szenen mit der auf grausame Weise auseinandergerissenen Familie gehören zu den mitreißendsten Momenten des Werkes, sie verursachen sowohl bei Fraser als auch bei den Zuschauern eine wachsende Wut auf das freundlich dreinschauende Scheusal auf der Anklagebank. Man will das Monster leiden und sterben sehen.
Wie bereits eingangs erwähnt, diente dessen Person als Vorlage für die Figur des Charlie Reece, dessen Geschichte der Autor William P. Wood in seinem Roman „Rampage“ verarbeitet hat, auf welchem wiederum der gleichnamige Thriller von William Friedkin basiert. Entstanden ist die Filmadaption bereits 1987. Aufgrund des Bankrotts der produzierenden „De Laurentiis Entertainment Group“ sollte es jedoch ganze fünf Jahre dauern, bis das Werk seinen Weg auf die US-amerikanischen Leinwände finden würde. Hierzulande tauchte es 1990 unter dem Titel „Anklage Massenmord“ ohne vorherigen Kinoeinsatz still und leise in den Regalen der Videotheken ab und dürfte bei den wenigsten Kunden großes Aufsehen erregt haben. Tatsächlich sind die Release-Umstände des Films mehr als bedauerlich, denn die extrem unangenehme und deprimierende Geschichte gehört nach dem Meisterwerk „Der Exorzist“ (1973) zum Intensivsten, was Regisseur Friedkin seinen Zuschauern je „zugemutet“ hat. Das liegt zum einen daran, dass er hier nicht versucht, einen Horrorfilm voll billiger Ekel-Momente zu erschaffen, sondern den provokanten Fall von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet: Von dem des Täters, denen der Opfer und dem des Staatsanwaltes Anthony Fraser. Letzterer wird von dem zuvor aus James Camerons „Terminator“ (1984) und „Aliens – Die Rückkehr“ (1986) bekannten Michael Biehn verkörpert, der in seiner Rolle als Gegner der Todesstrafe, dessen Überzeugungen durch die bestialischen Taten erschüttert werden, die wohl überzeugendste Leistung seiner Karriere abgeliefert hat. Auch Alex McArthur, der dem unheimlichen Charlie Reece sein Gesicht leiht, beeindruckt durch eine undurchsichtige Performance, die dem Publikum bis zum Schluss die Entscheidung schwer macht, ob sich unter dessen ruhiger Hülle ein schwer kranker Psychopath oder ein eiskalt berechnender Killer verbirgt. Um allerdings zunächst überhaupt einen emotionalen Berührungspunkt zu der Geschichte zu schaffen, führt Friedkin auch die Trauer des Familienvaters Gene Tippetts (Royce D. Applegate) vor Augen, der zusammen mit seinem jungen Sohn Andrew (Whit Hertford) die verstümmelte Leiche seiner Frau findet. Die Szenen mit der auf grausame Weise auseinandergerissenen Familie gehören zu den mitreißendsten Momenten des Werkes, sie verursachen sowohl bei Fraser als auch bei den Zuschauern eine wachsende Wut auf das freundlich dreinschauende Scheusal auf der Anklagebank. Man will das Monster leiden und sterben sehen. Angemerkt sei kurz, dass diese Rezension auf der deutschen VHS-Version basiert. Aufgrund einer mit der Zeit persönlich veränderten Sichtweise bezüglich des Themas Todesstrafe hat der Regisseur einige Szenen für den US-Release umgeschnitten und ein anderes Ende gewählt. Inwiefern sich die beiden Fassungen im Vergleich genau unterscheiden, ist an dieser Stelle nicht bekannt. Trotz der am Schluss spürbaren Ablehnung einer Exekution darf man das Werk nicht als pathetischen Moralzeigefinger abtun. Schon beachtlich ist die Nüchternheit, mit der während der Gerichtsszenen die Fakten vorgeführt werden, welche nach den gezeigten Grausamkeiten eben kein völlig befriedigendes Ende zulassen. „Rampage“ ist erschütterndes Drama, harter Schocker und packender Justizthriller zugleich – und dabei in erster Linie ein ganz schön schwer verdaulicher Brocken von Film. In der letzten Einstellung zeigt Friedkin Witwer Tippetts mit seinem Sohn auf einem Rummelplatz. Sie wollen vergessen, dem erlebten Schrecken entrinnen. Dann leitet Ennio Morricones beunruhigender Soundtrack den Abspann ein. Doch für die Zuschauer läuft der Film im Kopf noch weiter …
Angemerkt sei kurz, dass diese Rezension auf der deutschen VHS-Version basiert. Aufgrund einer mit der Zeit persönlich veränderten Sichtweise bezüglich des Themas Todesstrafe hat der Regisseur einige Szenen für den US-Release umgeschnitten und ein anderes Ende gewählt. Inwiefern sich die beiden Fassungen im Vergleich genau unterscheiden, ist an dieser Stelle nicht bekannt. Trotz der am Schluss spürbaren Ablehnung einer Exekution darf man das Werk nicht als pathetischen Moralzeigefinger abtun. Schon beachtlich ist die Nüchternheit, mit der während der Gerichtsszenen die Fakten vorgeführt werden, welche nach den gezeigten Grausamkeiten eben kein völlig befriedigendes Ende zulassen. „Rampage“ ist erschütterndes Drama, harter Schocker und packender Justizthriller zugleich – und dabei in erster Linie ein ganz schön schwer verdaulicher Brocken von Film. In der letzten Einstellung zeigt Friedkin Witwer Tippetts mit seinem Sohn auf einem Rummelplatz. Sie wollen vergessen, dem erlebten Schrecken entrinnen. Dann leitet Ennio Morricones beunruhigender Soundtrack den Abspann ein. Doch für die Zuschauer läuft der Film im Kopf noch weiter …





